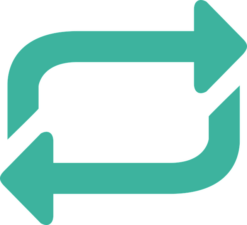Ich hatte Mitte Juni über den LG Bad Kreuznach, Beschl. v. 12.05.2024 – 2 Qs 14/24 – berichtet, in dem über den Gebührenanspruch eines Pflichtverteidigers entschieden worden ist, der nur für einen Vorführtermin bestellt worden ist (vgl. Pflichtverteidigerbestellung „für den heutigen Termin“, oder: Alle Gebühren, auch die Nr. 4142 VV RVG). In dem Posting hatte ich darauf hingewiesen, dass ich, da das LG die weitere Beschwerde zum OLG zugelassen hatte, gespannt bin, was das OLG Koblenz dazu sagt. Und inzwischen hat das OLG Koblenz sich geäußert, und zwar so, dass ich angenehm überrascht bin (was bei Entscheidungen vom OLG Koblenz nicht so häufig der Fall ist 🙂 . Denn das OLG hat die weitere Beschwerde, die die Bezirksrevisorin natürlich nicht eingelegt hat – „es kann doch nicht sein, dass …..“ 🙂 – mit dem OLG Koblenz, Beschl. v. 04.07.2024 – 2 Ws 412/24 – als unbegründet zurückgewiesen:
„a) Im Ansatz zutreffend geht die Bezirksrevisorin davon aus, dass maßgebend für das Kosten-festsetzungsverfahren der insofern bindende Beiordnungsbeschluss ist (BGH, Beschluss vom 11. April 2018 – Az. XII ZB 487/17; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 9. Mai 2018 – Az. III – 1 Ws 274/17; OLG Koblenz, Beschluss vom 26. Januar 2015 – Az. 13 WF 67/15 – alle zitiert nach juris). Für die Abgrenzung zwischen einem „Vollverteidiger“ und einem mit einer Einzeltätigkeit beauftragten Rechtsanwalt ist gemäß § 48 Abs. 1 RVG der Wortlaut der Verfügung des Vorsitzenden oder des Gerichtsbeschlusses maßgebend, durch den die Bestellung zum Pflichtverteidiger erfolgt ist (OLG Stuttgart, Beschluss vom 23. Januar 2023, Az. 4 Ws 13/23 – zitiert nach juris). Dem Wortlaut des hier vorliegenden Beiordnungsbeschlusses vom 21. Dezember 2022 ist eine Bei-ordnung „für den heutigen Termin“, mithin die Vorführung vor den Haftrichter gemäß § 115 StPO, zu entnehmen. Damit enthält der Beschluss eine zeitliche Beschränkung auf den Termin der Vorführung. Ob eine solche Beschränkung im Hinblick auf § 143 StPO zulässig ist, kann auf Grund der Bindungswirkung des Beiordnungsbeschlusses für das Kostenfestsetzungsverfahren dahinstehen. Eine inhaltliche Beschränkung auf die Haftfrage ist dem Beschluss dagegen nicht zu entnehmen (vgl. auch OLG Karlsruhe, Beschluss vom 9. Februar 2023 – Az. 2 Ws 13/23 – zitiert nach juris; aA für den – hier nicht vorliegenden – Fall eines schon beauftragten Wahlverteidigers: OLG Stuttgart, aaO).
Demzufolge ist bei der Festsetzung der Gebühren von der für den Termin der Vorführung erforderlichen, tatsächlich angefallenen anwaltlichen Tätigkeit auszugehen, soweit sie sich im Rahmen dieses Beiordnungsbeschlusses hält. Dies ist jedenfalls dann, wenn wie vorliegend noch kein anderer Verteidiger bestellt ist, sondern ein solcher bloß die Bereitschaft zur Übernahme der Verteidigung erklärt hat, beim Vorführungstermin jedoch verhindert ist, nicht allein die Einzeltätigkeit nach Nr. 4301 VV RVG. Nach Absatz 1 der Vorbemerkung 4.3 VV RVG entstehen die Gebühren für einzelne Tätigkeiten, ohne dass dem Rechtsanwalt sonst die Verteidigung oder Vertretung übertragen ist. Der Verteidiger war hier jedoch nicht nur „für den Termin“ mit einer einzelnen Tätigkeit im Sinne des Absatzes 1 der Vorbemerkung zu 4.3 beauftragt, sondern ihm wurde vielmehr eine Vollverteidigung übertragen. Die Tätigkeit im Rahmen des Vorführtermins erschöpft sich nämlich nicht alleine in der insofern in Betracht zu ziehenden Betätigung nach Nr. 4301 Ziff. 4 VV RVG (Beistandsleistung für den Beschuldigten im Rahmen einer richterlichen Vernehmung). Die richterliche Vernehmung ist zwar gemäß § 115 Abs. 2 StPO Teil einer Eröffnung eines Haftbefehls, diese geht jedoch darüber hinaus. Vorliegend war eine Erstberatung noch nicht erfolgt. Daher war – unabhängig von der später erfolgten Beiordnung eines anderen Verteidigers – eine umfassende Beratung zur Verteidigungsstrategie im Termin zur Vorführung nach § 115 StPO zwingend geboten. So war beispielsweise bereits zu diesem Zeitpunkt zu entscheiden, ob sich durch eine Einlassung ein dringender Tatverdacht ausräumen lässt oder sich eine (geständige) Einlassung auf die Frage einer Außervollzugsetzung des Haftbefehls auswirken kann. Die gewählte Vorgehensweise kann sich gegebenenfalls bestimmend für das Verteidigungsverhalten im weiteren Verfahrensverlauf auswirken. Dies gilt ebenso für die Frage der Beratung zu einer drohenden Einziehung.
Diesen Gegebenheiten wird bei bislang noch nicht erfolgter Erstberatung trotz zeitlicher Beschränkung der Aufgabenwahrnehmung nur durch eine volle Pflichtverteidigung Rechnung getragen (vgl. auch K. Sommerfeldt/T. Sommerfeldt in: BeckOK RVG, 64. Ed. § 48 Rdn. 121). Durch die Beiordnung eines Verteidigers für die Wahrnehmung eines Termins wird daher ein eigenständiges, vollumfängliches öffentlich-rechtliches Beiordnungsverhältnis begründet, aufgrund dessen der bestellte Verteidiger während der Dauer seiner Bestellung die Verteidigung des Angeklagten umfassend und eigenverantwortlich wahrzunehmen hat.
b) Daraus folgt, wie die Kammer zutreffend ausgeführt hat: die Grundgebühr nebst Haftzuschlag (Vorbemerkung 4 Ziffer 4 VV RVG) gemäß Nummer 4101 VV RVG deckt die erforderliche Einarbeitung in den Fall ab, daneben fällt die Verfahrensgebühr gemäß Nummer 4105 VV RVG an. Der Vorführungstermin zur Verkündung des Haftbefehls gemäß § 115 StPO erfüllt ohne weiteres die Voraussetzungen von Nummern 4102 Ziffer 3, 4103 VV RVG, wonach die Terminsgebühr mit Zuschlag für die Teilnahme an Terminen außerhalb der Hauptverhandlung anfällt, in denen über die Anordnung oder Fortdauer der Untersuchungshaft verhandelt wird. Gleiches gilt – im Hinblick auf die drohende Einziehung – gemäß Nummer 4142 VV RVG.
Etwas anderes lässt sich auch nicht aus dem Gebührentatbestand der Nummer 4301 Ziff. 4 VV RVG herleiten. Dieser regelt die Vergütung für die Beistandsleistung für den Beschuldigten bei einer richterlichen Vernehmung im Rahmen einer Einzeltätigkeit. Die Einzeltätigkeit setzt voraus, dass dem Rechtsanwalt nicht die Verteidigung übertragen worden ist. Dies ist hier aber gerade nicht der Fall (vgl. oben 2. a)).
Hiergegen kann auch nicht angeführt werden, dass der Gebührentatbestand Nr. 4301 Ziff. 4 VV RVG ins Leere laufe, da als Anwendungsfall zumindest die Tätigkeit im Rahmen des § 140 Abs. 1 Nr. 10 StPO verbleibt.“
Anzumerken ist: Eine weitere (obergerichtliche) Entscheidung in der Frage, welche Gebühren für den nur für einen Vorführtermin bestellten Pflichtverteidiger anfallen. Allmählich kann man die Auffassung, die in diesen Fällen nicht nur von einer Einzeltätigkeit ausgeht, sondern den Pflichtverteidiger als „vollen Verteidiger“ ansieht, der nach Teil 4 Abschnitt 1 VV RVG alle (Verteidiger)Gebühren abrechnen kann, als herrschende Meinung ansehen.
Mit der Begründung des OLG Koblenz kann ich mich allerdings nicht so richtig anfreunden, da das OLG das gefundene Ergebnis offenbar sogleich wieder einschränken will. Denn das OLG will – so ist es m.E. zu verstehen – von Teil 4 Abschnitt 1 VV RVG und damit vom Anfall aller Gebühren wohl nur dann ausgehen, „wenn wie vorliegend noch kein anderer Verteidiger bestellt ist, sondern ein solcher bloß die Bereitschaft zur Übernahme der Verteidigung erklärt hat.“ Diese Sicht der Dinge ist m.E. falsch. Denn auch, wenn bereits ein Verteidiger bestellt ist oder sich bestellt hat, muss der Verteidiger im/für den Vorführtermin die vom OLG beschriebenen Verteidigertätigkeiten erbringen. Das ist/wäre aber originäre volle Verteidigertätigkeit und geht weit über das hinaus, was über eine Einzeltätigkeit nach Nr. 4301 Ziff. 4 VV RVG abzurechnen wäre. Von daher ist die Entscheidung „unschön“ und mutet ein wenig wie die Echternacher Springprozession: Zwei Schritte vor, einer zurück.