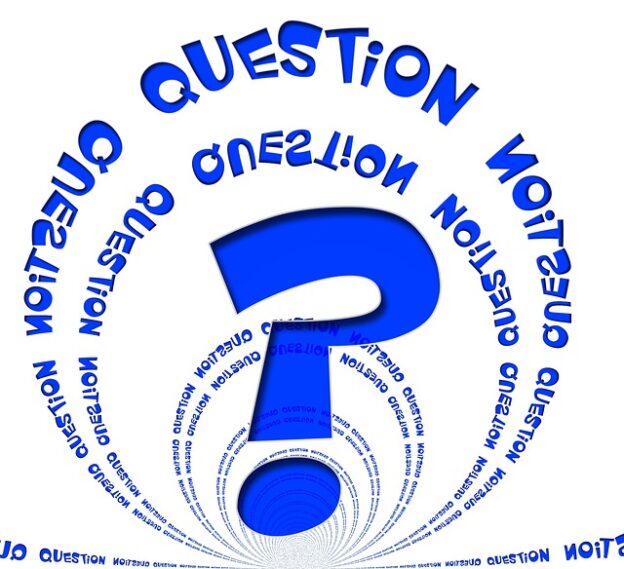„2. Diese Ablehnung des Beweisantrags hält rechtlicher Nachprüfung nicht stand.
a) Genügt ein erkennbar als Beweisantrag vorgebrachtes Beweisbegehren seinem Wortlaut nach nicht den Anforderungen an die notwendige Konkretisierung der Beweistatsache, ist es in sonstiger Weise lückenhaft, ungenau formuliert oder mehrdeutig oder bleibt unklar, welcher einsichtige Prozesszweck mit ihm verfolgt werden soll, und lassen sich die hieraus resultierenden Zweifel nicht ohne weiteres eindeutig aus den gesamten Umständen der Antragstellung ausräumen, so ist der Vorsitzende aufgrund der Aufklärungspflicht, die ein Hinwirken auf eine sachdienliche Antragstellung gebietet, der Fürsorgepflicht sowie der Verfahrensfairness (Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK) grundsätzlich gehalten, den Antragsteller zunächst auf die Bedenken gegen seinen Antrag hinzuweisen und ihm durch entsprechende Befragung Gelegenheit zu geben, die erforderliche Klarstellung vorzunehmen (vgl. BGH, Urteil vom 16. April 1996 ? 1 StR 120/96, NStZ-RR 1996, 336, 337; Beschluss vom 8. Februar 1996 ? 4 StR 776/95, NStZ 1996, 562; LR-StPO/Becker, 27. Aufl., § 244 Rn. 115; KK-StPO/Krehl, 9. Aufl., § 244 Rn. 78). Auch wenn dies nicht zum Erfolg führt, bleibt das Gericht verpflichtet, die vom Antragsteller tatsächlich gewollte Beweisbehauptung durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH, Urteil vom 26. Januar 2000 ? 3 StR 410/99, NStZ 2000, 267, 268 mwN). Diese kann sich nicht nur aus dem Wortlaut des Antrags, sondern aus allen Umständen, die bei einer nach Sinn und Zweck fragenden Auslegung zu berücksichtigen sind, ergeben (vgl. BGH, Urteil vom 9. Juli 2015 – 3 StR 516/14, StV 2016, 337, 338; Beschlüsse vom 11. April 2007 – 3 StR 114/07, juris Rn. 7; und vom 6. März 2014 – 3 StR 363/13, NStZ 2014, 419). Bei mehreren Interpretationsalternativen ist derjenigen der Vorzug zu geben, die zur Beweiserhebung führt (vgl. BGH, Urteil vom 11. Juli 1984 ? 2 StR 320/84, NStZ 1984, 564, 565; Beschluss vom 12. Mai 2022 – 5 StR 450/21, juris Rn. 15 mwN).
Ferner muss nach der ständigen Rechtsprechung der Beschluss, mit dem ein Beweisantrag wegen Bedeutungslosigkeit der behaupteten Tatsache abgelehnt wird, die Erwägungen anführen, aus denen das Tatgericht der unter Beweis gestellten Tatsache aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen keine Bedeutung für den Schuld- oder Rechtsfolgenausspruch beimisst. Für die zu treffende Entscheidung ohne Bedeutung ist eine Tatsache nur dann, wenn ein Zusammentreffen zwischen ihr und der abzuurteilenden Tat nicht besteht oder wenn sie trotz eines solchen Zusammenhangs nicht geeignet ist, die Entscheidung irgendwie zu beeinflussen, wobei sich das Gericht im Urteil nicht in Widerspruch zu der Ablehnungsbegründung setzen darf (vgl. BGH, Beschlüsse vom 20. August 1996 – 4 StR 373/96, BGHR StPO § 244 Abs. 3 Satz 2 Bedeutungslosigkeit 22; und vom 7. November 2023 – 2 StR 284/23, NStZ 2024, 177, 178; jew. mwN).
b) Hieran gemessen erweist sich die Ablehnung des Beweisantrags als rechtsfehlerhaft.
aa) Die Strafkammer hat das dem Beweisantrag bei verständiger Würdigung zugrundeliegende Beweisthema nur verkürzt behandelt und so den Antrag schon nicht in einem zur Beweiserhebung führenden Sinne ausgelegt.
Der notwendigen Behandlung als Beweisantrag steht zunächst nicht entgegen, dass der Antrag seinem Wortlaut nach zwar positiv formuliert, jedoch inhaltlich auf eine Negativtatsache gerichtet war. Denn der Antrag ist bei verständiger Auslegung – naheliegend ? dahingehend zu verstehen, dass unter Beweis gestellt war, es habe zwischen dem Angeklagten und Ü. keine betäubungsmittelbezogenen Kontakte gegeben. Eine dahingehende Auslegung drängte sich auch deshalb auf, weil die Verteidigung des Angeklagten zuvor einen – von der Strafkammer mangels bestimmter Tatsachenbehauptung rechtsfehlerfrei abgelehnten – „Beweisantrag“ auf Einvernahme des Ü. mit derselben Stoßrichtung gestellt hatte. Darin hatte sie beantragt, Ü. als Zeugen zum Beweis der Tatsache zu vernehmen, dass dieser ausschließlich mit J. Betäubungsmittelhandel betrieben habe. Mit dem der Verfahrensrüge zugrunde liegenden ? in enger zeitlicher Abfolge gestellten ? Beweisantrag wollte die Verteidigung bei gleichem Beweisziel ihr Beweisthema konkretisieren, was sie im Beweisantrag durch die beispielhafte Aufzählung verschiedener Handlungssequenzen, die ausschließlich zwischen Ü. und J. stattgefunden haben sollten ? „Drogen verkauft“, „Absprachen gehalten“ und „geschäftlichen Beziehung“ ? zum Ausdruck brachte. Soweit die Strafkammer ausführt, dass schon unklar sei, was Gegenstand der „Absprache“ oder was mit „geschäftlichen Beziehung“ gemeint sei, und insoweit eine konkrete Tatsachenbehauptung vermisst, hat sie bei der gebotenen Auslegung des Beweisantrags dessen Beweisthema und Zielrichtung unzulässig verkürzt.
bb) Infolgedessen hat die Strafkammer den Beweisantrag rechtsfehlerhaft allein am Maßstab der rechtlichen Bedeutungslosigkeit gemessen und dabei den tatsächlichen Gehalt der unter Beweis gestellten Tatsachen außer Betracht gelassen. Sie hat deshalb bei ihrem Ablehnungsbeschluss verkannt, dass der Beweisantrag nicht darauf abzielte, aus dem Umstand der ausschließlichen betäubungsmittelbezogenen Kommunikation zwischen Ü. und J. die Annahme einer bandenmäßigen Tatbegehung unter Beteiligung des Angeklagten zu widerlegen. Insofern hat sie zwar – für sich genommen rechtsfehlerfrei – angenommen, dass die unter Beweis gestellte Tatsache der Absprachen ausschließlich zwischen Ü. und J. eine Bandenabrede nicht ausschloss (vgl. BGH, Urteil vom 23. April 2009 – 3 StR 83/09, juris Rn. 9). Sie hat jedoch nicht in den Blick genommen, dass bei sachgerechter Auslegung des Antrags nachgewiesen werden sollte, dass – unabhängig von der rechtlichen Einordnung als Bande – zwischen dem Angeklagten und Ü. zu keiner Zeit betäubungsmittelbezogene Kontakte bestanden und damit insbesondere Rückschlüssen in tatsächlicher Hinsicht entgegengetreten werden sollte, der Angeklagte und Ü. hätten über den Kryptodienst A. unter Pseudonymen miteinander kommuniziert. Mit diesem Gesichtspunkt befassen sich die Ablehnungsgründe nicht.
cc) Die Ablehnung des Beweisantrags erweist sich zudem aus einem weiteren Grund als rechtsfehlerhaft. Denn das Gericht muss sich an der dem Ablehnungsbeschluss zugrundeliegenden Annahme der Bedeutungslosigkeit der Beweistatsache festhalten lassen. Es darf sich im Urteil nicht zu der Ablehnungsbegründung in Widerspruch setzen oder seine Überzeugung auf das Gegenteil der unter Beweis gestellten Tatsache stützen (vgl. BGH, Urteil vom 19. September 2007 – 2 StR 248/07, StraFo 2008, 29; Beschlüsse vom 20. August 1996 – 4 StR 373/96, BGHR StPO § 244 Abs. 3 Satz 2 Bedeutungslosigkeit 22; vom 29. April 2014 – 3 StR 436/13, juris Rn. 3).
Hiergegen hat die Strafkammer verstoßen, indem sie – allein orientiert an der defizitären Auslegung des Beweisantrags ? feststellte, dass Ü. dem Angeklagten Anweisungen gab, an wen die Betäubungsmittel auszuliefern seien und wie – nach der Festnahme des J. – im Hinblick auf die im Bunker vorrätig gehaltenen Drogen der Gruppierung zu verfahren sei. Damit hat sie entgegen dem vorgenannten Verständnis des Beweisantrags der behaupteten Beweistatsache nicht nur eine die Entscheidung tragende Bedeutung beigemessen, sondern sogar das Gegenteil davon festgestellt.“