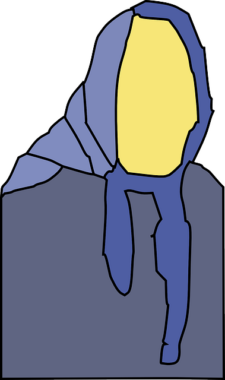Und als zweite Entscheidung dann etwas aus dem „Schöffenrecht“, also eher GVG, aber natürlich mit Auswirkungen auf die StPO. Es geht nämlich um die Frage: Was passiert, wenn sich eine Schöffin aus religiösen Gründen weigert, während der Hauptverhandlung, ihr Kopftuch abzulegen? Ist das eine gröbliche Amtspflichtverletzung oder eine Unfähigkeit, das Schöffenamit auszuüben.
„Der Antrag auf Amtsenthebung der Schöffin war abzulehnen, da ihre Weigerung, das Kopftuch während der Gerichtsverhandlung abzunehmen, keine gröbliche Amtspflichtverletzung im Sinne von § 51 Abs. 1 GVG darstellt.
1. Im Ansatz zutreffend ist der Vorsitzende des Jugendschöffenausschusses davon ausgegangen, dass die Weigerung der Schöffin, während der Gerichtsverhandlung auf das Tragen des Kopftuches zu verzichten, gegen § 2 Abs. 1 JNeutG NRW verstößt, wonach ehrenamtliche Richter in der gerichtlichen Verhandlung keine wahrnehmbaren Symbole oder Kleidungsstücke tragen dürfen, die bei objektiver Betrachtung eine bestimmte religiöse Auffassung zum Ausdruck bringen.
2. Ferner bestehen keine durchgreifenden rechtlichen Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit von § 2 Abs. 1 JNeutG NRW. Der Senat nimmt insofern Bezug auf die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Arnsberg (Beschluss vom 9. Mai 2022 – 2 L 102/22 -, Rn. 27 – 32, juris; ebenso: Beaucamp/Thrun, ZJS 2020, 373 ff.) und teilt insbesondere dessen Auffassung, dass das Verbot des Tragens religiöser Symbole während der Gerichtsverhandlung sich im Hinblick auf den hohen Rang des staatlichen Neutralitätsgebots und die geringe Eingriffsintensität als verhältnismäßig darstellt.
3. Nach Auffassung des Senats stellt die Weigerung der Schöffin, das Kopftuch während der Gerichtsverhandlung abzunehmen, indes keine gröbliche Amtspflichtverletzung im Sinne von § 51 Abs. 1 GVG, sondern eine (sonstige) Unfähigkeit zur Ausübung des Schöffenamtes im Sinne von § 52 Nr. 1 GVG dar.
a) Amtsenthebungsverfahren nach § 51 Abs. 1 GVG und Streichung von der Schöffenliste nach § 52 Abs. 1 GVG stehen in einem Ausschließlichkeitsverhältnis zueinander, so dass die Entscheidung, ob ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten oder eine Streichung von der Schöffenliste vorzunehmen ist, nur entweder in die eine oder in die andere Richtung getroffen werden kann (OLG Celle, Beschluss vom 23. September 2014 – 2 ARs 13/14 -, Rn. 3, juris)
b) Ob die Nichtausübbarkeit des Schöffenamtes wegen des Tragens religiöser Kleidung unter § 51 GVG oder § 52 GVG zu fassen ist, wird uneinheitlich beantwortet und ist seit Einführung von § 2 JNeutG NRW – soweit ersichtlich – bislang nicht entschieden.
aa) Teilweise wird eine Unfähigkeit zur Ausübung des Schöffenamtes verneint (AG Fürth (Bayern), Beschluss vom 7. Dezember 2018 – 441 AR 31/18 -, juris; KG Berlin, Urteil vom 9. Oktober 2012 – (3) 121 Ss 166/12 (120/12) -, juris). Begründet wird dies damit, dass § 52 GVG Bezug auf die §§ 32 bis 34 GVG nehme, in welchem das Tragen eines Kopftuchs nicht genannt werde. Wegen des hohen Grades an demokratischer Legitimation sei eine enge Auslegung von § 52 GVG geboten. Zudem bestehe für die Schöffin jeweils die Möglichkeit, gem. § 54 Abs. 1 S. 1 GVG ihre Entbindung von Dienstleistungen an bestimmten Sitzungstagen zu beantragen, solange sie sich aus religiösen Gründen nicht in der Lage sehe, in der Öffentlichkeit ihr Kopftuch abzulegen (AG Fürth (Bayern), Beschluss vom 7. Dezember 2018 – 441 AR 31/18 -, juris).
bb) Die Gegenauffassung geht hingegen davon aus, dass eine Streichung nach § 52 Abs. 1 GVG von der Schöffenliste geboten sei (Goers, in: Beck´scherOK, Stand: 15.02.2024, § 51 GVG Rn. 17a; Schmidt/Schiemann in: Gercke/Temming/Zöller, 7. Auflage 2023, § 51 GVG, Rn. 3; AG Hamburg-St. Georg, Beschluss vom 28. Dezember 2018 – ID 847 -, juris; in diese Richtung wohl auch: Gittermann in: Löwe-Rosenberg, StPO, 27. Auflage, § 31 GVG, Rn. 19c), da die Erklärung, während der Hauptverhandlung ein Kopftuch tragen zu wollen, keine gröbliche Amtspflichtverletzung darstelle.
c) Der Senat folgt der letztgenannten Auffassung.
aa) Die gröbliche Verletzung der Amtspflichten im Sinne von § 51 GVG wird nach dessen Sinn und Zweck allgemein als Verhalten definiert, welches den Schöffen aus objektiver Sicht eines verständigen Verfahrensbeteiligten ungeeignet für die Schöffenamtsausübung macht, weil er nicht mehr die Gewähr bietet, unparteiisch und nur nach Recht und Gesetz zu entscheiden. (Goers, in: Beck´scherOK, a.a.O., § 51 GVG Rn. 9). Vorliegend geht es indes nicht um ein Fehlverhalten der Schöffin – diese praktiziert vielmehr lediglich ihre durch Art. 4 Abs. 1 GG geschützte Religionsausübungsfreiheit – sondern um eine Kollision der grundrechtlich geschützten Religionsausübung mit den staatlichen Neutralitätsvorgaben bei Ausübung des Schöffenamtes.
bb) Ferner ist ersichtlich gesetzgeberisch nicht intendiert, dass Personen als Schöffen berufen werden, die nicht nur vorübergehend, sondern dauerhaft an der Ausübung des Schöffenamtes gehindert sind. Dies wäre indes die Folge, wenn man das religiöse Kopftuchtragen nicht als fehlende Eignung zur Ausübung des Schöffenamtes, sondern als gröbliche Amtspflichtverletzung verstehen würde. Bei dem letztgenannten Verständnis wäre eine Schöffin auch in Kenntnis des vorgenannten Umstandes zunächst zu berufen.
Soweit das Amtsgericht Fürth in diesem Zusammenhang die Auffassung vertritt, dass Schöffinnen nach ihrer Berufung jeweils ihre Entbindung gem. § 54 Abs. 1 GVG von der Dienstleistung an bestimmten Sitzungstagen beantragen müssten, wenn sie sich aus religiösen Gründen zum Ablegen des Kopftuches in der Öffentlichkeit nicht in der Lage sehen würden, und die unterlassene Stellung des Entbindungsantrags eine gröbliche Amtspflichtverletzung darstellen kann (AG Fürth (Bayern), Beschluss vom 7. Dezember 2018 – 441 AR 31/18 -, juris Rn. 14, 16), vermag dies nicht zu überzeugen. Denn die ständige Beantragung der Entbindung nach § 54 GVG stellt nicht nur einen mit erheblichem bürokratischen Aufwand verbundenen Formalismus dar, sondern führt bei einer gefestigten religiösen Überzeugung der Schöffin – wie hier – auch zum gleichen Ergebnis wie deren Streichung von der Schöffenliste.
Anerkannt ist zudem, dass über den Wortlaut von § 52 GVG hinaus auch sonstige Gründe die Unfähigkeit zur Ausübung des Schöffenamtes begründen können (Schmitt, in: Meyer-Goßner, 66. Aufl. 2023, § 52 GVG Rn. 1; Barthe, in: Karlsruher Kommentar, 9. Aufl. 2023, § 52 GVG Rn. 4; Duttge/Kangarani, in: HK-GS, 5. Aufl. 2022, § 52 Rn. 2 GVG).
d) Der Senat ist aus den vorgenannten Gründen gehindert, die Schöffin nach § 51 Abs. 1 GVG ihres Amtes zu entheben. Der Senat vermag zudem die Schöffin nicht aus der Schöffenliste zu streichen. Denn zuständig für die Streichung aus der Schöffenliste nach § 52 GVG ist nicht der Senat, sondern der geschäftsplanmäßig für die Schöffenangelegenheiten im Sinn der §§ 31 ff. GVG i.V.m. § 34 Abs. 1 JGG bestimmte Jugendrichter (Schuster, in: MünchKomm, 1. Aufl. 2018, § 52 GVG Rn. 11), vorliegend somit der Vorsitzende des Jugendschöffenausschusses. Dessen Entscheidung ist gem. § 52 Abs. 4 GVG unanfechtbar.