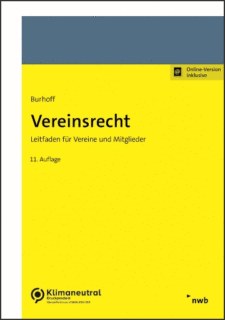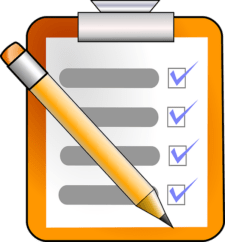Und im zweiten Posting dann das AG St. Ingbert, Urt. v. 12.12.2023 – 22 OWi 66 Js 1319/23 (2348/23). Thematik: Auch die Auslagenerstattung nach Einstellung wegen eines Verfahrenshidnernisses. Ich habe diese Entscheidung bewusst nicht heute morgen mit den anderen – positiven – Entscheidungen vorgestellt, da ich mit dem Urteil erhebliche Probleme habe, wie leider häufig mit Entscheidungen von dem Gericht.
Das AG hat in dem Urteil das Bußgeldverfahren eingestellt, weil Verjährung eingetreten war. Gegen den Betroffenen waren wegen desselben Vorwurfs insgesamt zwei Bußgeldbescheide: ergangen: Einmal mit Datum vom 24.01.2023, wobei in diesem Bußgeldbescheid ein falscher Nachname des Betroffenen angegeben war. Dieser Bußgeldbescheid konnte daher dem Betroffenen nicht wirksam zugestellt werden. Dem Verteidiger des Betroffenen wurde dieser Bußgeldbescheid mit Verfügung vom 24.01.2023 formlos übersandt.
Nachdem die Behörde den richtigen Nachnamen des Betroffenen ermittelt hatte, erging nunmehr der Bußgeldbescheid vom 27.01.2023, wobei mit diesem Bußgeldbescheid der alte weder aufgehoben noch zurückgenommen wurde.
Das AG geht davon aus, dass dieser zweite Bußgeldbescheid wegen Verstoß gegen den Verfassungsgrundsatz „ne bis in idem „(Art. 103 Abs. 3 Grundgesetz) nichtig war. Der zuerst ergangene Bußgeldbescheid wäre aber trotz falscher Namensangabe grundsätzlich wirksam, jedoch konnte diese dem Betroffenen nicht zugestellt werden, so dass Verfolgungsverjährung eingetreten war.
Also Einstellung des Verfahrens nach § 260 Abs. 3 StPO, 46 OWiG. Zur Kostenentscheidung führt das AG dann aus:
„Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 46 OWiG, 467 StPO, wobei es gerechtfertigt erschien, die notwendigen Auslagen des Betroffenen nicht der Staatskasse aufzuerlegen. Der Betroffene wurde mit Anhör- Schreiben vom 17.11.2022 (Blatt 5 d.A.) zu der Sache angehört, wenn auch mit Angabe des falschen Nachnamens. Hierauf hin beauftragte er offensichtlich seinen Verteidiger, der sich mit Schreiben vom 24.11.2022 (7 d.A.) als Verteidiger des Betroffenen bestellte und vorsorglich Einspruch einlegte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Betroffene somit Kenntnis von dem Vorwurf und dem gegen ihn eingeleiteten Verfahren; ferner war für ihn ersichtlich, dass ein falscher Nachname angegeben war. Der zuerst erlassene Bußgeldbescheid konnte zwar dem Betroffenen wegen Angabe falschen Nachnamens nicht zugestellt werden, dieser wurde jedoch dem Verteidiger übersandt, sodass der Betroffene frühzeitig darüber informiert war, dass die Behörde fälschlicherweise (Gründe dafür sind aus der Akte nicht ersichtlich) einen falschen Nachnamen angegeben hatte, wobei die übrigen Angaben ausreichend sind und waren, den Betroffenen als solchen zu identifizieren, somit keine Verwechslungsgefahr bestand. Der 2. Bußgeldbescheid wurde dem Betroffenen dann förmlich zugestellt, worauf hin vom Verteidiger Einspruch eingelegt wurde.
Eine Verurteilung des Betroffenen wegen des vorgeworfenen Verstoßes (Verkehrsordnungswidrigkeit) wäre nach Aktenlage und der vorhandenen Beweismittel wahrscheinlich gewesen.“
M.E. falsch. Man möchte schreien wenn man es liest, so falsch ist die Entscheidung. Denn es handelt sich im Hinblick auf die Rechtsprechung des BVerfG (vgl. u.a. BVerfG, Beschl. v. 26.05.2017 – 2 BvR 1821/16) sicherlich nicht um ein vorwerfbar prozessuales Fehlverhalten des Betroffenen, wenn er auf einen solchen Umstand nicht hinweist. Der nemo-tenetur-Grundsatz gilt auch im Bußgeldverfahren. Das bedeutet, dass der Betroffene auf solche Umstände, die ggf. zu seiner Verurteilung beitragen würden, nicht hinweisen muss. Das scheint sich noch nicht überall im Saarland herum gesprochen zu haben.