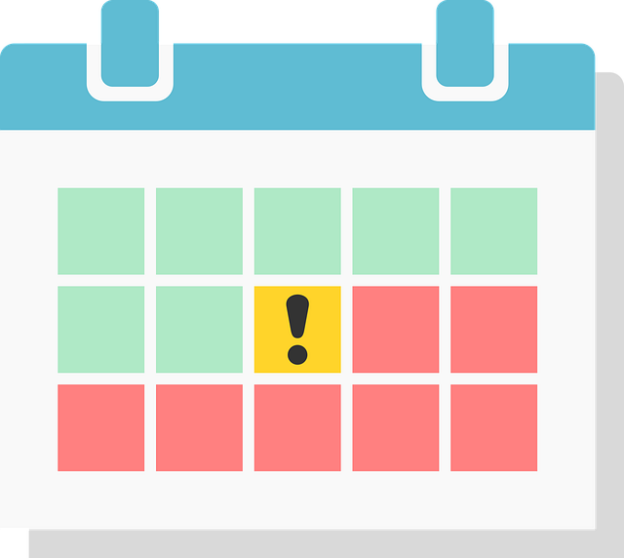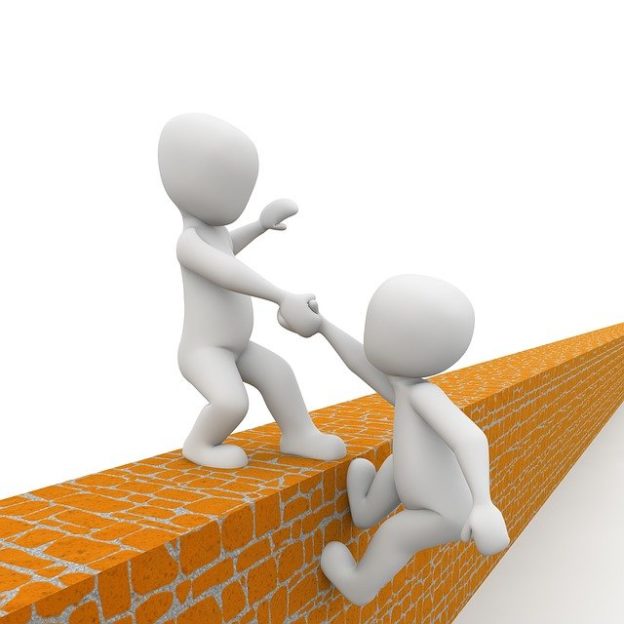Im zweiten Posting dann etwas von einem Landesverfassungsgericht zur Durchsuchung, und zwar der VerfG Brandenburg, Beschl. v. 21.06.2024 – VfGBbg 35/21.
Zugrunde liegt der Entscheidung ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Beschwerdeführer ist sorgeberechtigter Vater seiner im Jahr 2013 geborenen Tochter. Von der ebenfalls sorgeberechtigten Kindesmutter ist er seit Januar 2016 rechtskräftig geschieden. Seit der Trennung im Februar 2014 hatte der Beschwerdeführer zunächst regelmäßig Umgang mit seiner Tochter. Ab dem Jahr 2019 war das Umgangsrecht auf Veranlassung der Kindesmutter eingeschränkt. Am 12. 012021 erstattete diese Strafanzeige gegen den Beschwerdeführer, woraufhin das Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war, das zwischenzeitlich mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt worden ist.
Am 21.01.2021 ordnete das AG wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern die Durchsuchung der Wohn- und Geschäfts-räume, einschließlich aller Nebenräume und Kraftfahrzeuge sowie der Person des Beschwerdeführers, an. Daneben wurde die Beschlagnahme eventuell vorgefundener Beweismittel, wie Computer, Laptops, Mobiltelefone, Digitalkameras und anderer Speichermedien, angeordnet. In der Begründung des Beschlusses wird ausgeführt:
„Es besteht gegen den Beschuldigten aufgrund der bisherigen Ermittlungsergebnisse der Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Verdacht beruht auf den bisherigen Ermittlungsergebnissen, insbesondere auf Zeugenaussagen sowie zur Akte gereichten Berichte. Danach besteht der Anfangsverdacht gegen den Beschuldigten, zwei Kinder mit der weiteren Be-schuldigten pp. sexuell missbraucht zu haben, wobei Teile der Taten gefilmt worden sein sollen.“
Gegen diese Durchsuchungsanordnung geht der ehemalige Beschuldigte vor. Er hat aber weder beim AG noch beim LG Erfolg. Das VerfG gibt ihm dann endlich Recht:
„….. 2. Die angegriffenen Entscheidungen tragen den aus Art. 15 Abs. 2 LV folgenden Anforderungen an die Begrenzungsfunktion von Durchsuchungsanordnungen nicht hinreichend Rechnung.
a) Der Beschluss des Amtsgerichts enthält zunächst keine Angabe zum Tatzeitraum (vgl. zu diesem Erfordernis BVerfG, Beschluss vom 4. April 2017 2 BvR 2551/12 -, Rn. 21 ff., juris). Die Begründung des Beschlusses vermittelt auch sonst keine Anhaltspunkte für eine Begrenzung des Tatzeitraums. Vielmehr ermöglicht die mit dem Beschluss getroffene Anordnung der Sache nach eine Durchsuchung und Beschlagnahme von Beweismitteln für einen unbestimmten Zeitraum und wird bereits deshalb seiner Begrenzungsfunktion nicht gerecht.
b) Darüber hinaus lassen sich der Begründung des Beschlusses des Amtsgerichts keine hinreichenden tatsächlichen Angaben über das dem Beschwerdeführer konkret vorgeworfene strafrechtswidrige Verhalten entnehmen, dessen Aufklärung die An-ordnung der Durchsuchung dienen soll.
Die Beschlussbegründung erwähnt nur schlagwortartig den „Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern“, bezieht sich auf bisherige, allerdings nicht näher beschriebene Ermittlungsergebnisse, insbesondere auf Zeugenaussagen und zur Akte gereichte Berichte, und behauptet dann formelhaft, dass nach diesen Unterlagen der Anfangsverdacht gegen den Beschwerdeführer bestehe, zwei Kinder mit einer weiteren Beschuldigten sexuell missbraucht zu haben, wobei Teile der Tat gefilmt worden seien.
Offen erscheint danach bereits, unter welchen der in § 176a StGB geregelten Qualifikationstatbestände in der bis zum 30. Juni 2021 geltenden Fassung der Tatvorwurf einzuordnen ist. Der Beschlussinhalt lässt sich zwar dahin deuten, dass das Amtsgericht seinen Tatvorwurf auf § 176a Abs. 2 Nr. 1 a. F. StGB stützt. Danach macht sich strafbar, wer als Person über achtzehn Jahren mit dem Kind den Beischlaf vollzieht oder ähnliche sexuelle Handlungen an ihm vornimmt oder an sich vornehmen lässt, die mit dem Eindringen in den Körper verbunden sind. An diesem Tatbestand orientierte konkrete Lebenssachverhalte werden in dem Durchsuchungsbeschluss nicht bezeichnet, obwohl dies, wie der Nichtabhilfebeschluss des Amtsgerichts vom 12. April 2021 zeigt, ohne Weiteres mit Hilfe der in der angefochtenen Durchsuchungsanordnung bezeichneten Unterlagen möglich gewesen wäre. Entsprechende Handlungen erschließen sich jedenfalls nicht aus der Bemerkung des Amtsgerichts, Teile der Taten seien gefilmt worden.
Soweit die in dem Durchsuchungsbeschluss enthaltene – möglicherweise versehentliche – Formulierung des Betreffs („wegen des Verdachts des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Wiederholungstäter“) auf § 176a Abs. 1 a. F. StGB verweist, enthält der Beschluss des Amtsgerichts keine Angaben darüber, ob der Beschwerdeführer innerhalb der letzten fünf Jahre wegen einer Straftat nach § 176 Abs. 1 oder 2 StGB rechtskräftig verurteilt worden ist. Der in der Beschlussbegrün-dung enthaltene Hinweis des Amtsgerichts, dass Teile der Taten gefilmt worden sein sollen, könnte dahingehend verstanden werden, dass sich der Tatvorwurf auch auf § 176a Abs. 3 a. F. StGB stützen soll. Insoweit fehlt es aber an Angaben dazu, ob der Beschwerdeführer als Täter oder anderer Beteiligter in der Absicht gehandelt hat, die Tat zum Gegenstand eines pornographischen Inhalts (§ 11 Abs. 3 StGB) zu machen, der i. S. d. § 184b Abs. 1 oder 2 StGB verbreitet werden soll.
c) Die beschriebenen Mängel bei der ermittlungsrichterlich zu verantwortenden Um-schreibung des Tatvorwurfs in zeitlicher und sachlicher Hinsicht konnten weder durch den Nichtabhilfebeschluss des Amtsgerichts vom 12. April 2021 noch durch das Landgericht im Beschwerdeverfahren geheilt werden.“