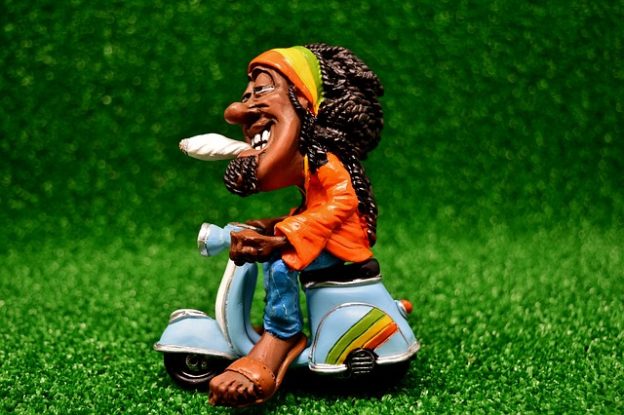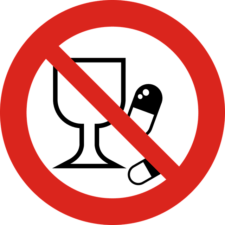Im zweiten Posting stelle ich dann den OVG Greifswald, Beschl. v. 20.06.2024 – 1 M 166/24 – vor. Er ist zwar auch in einem Verfahren wegen der Entziehung der Fahrerlaubnis ergangen, es geht aber nicht so sehr um die dafür erforderlichenn Voraussetzungen, sondern vornehmlich um die Anforderungen an das Vorbringen des Betroffenen im Falle der unbewussten Einnahme von Betäubungsmitteln:
„(1) Die Erfolgsaussichten des vom Antragsteller erhobenen Widerspruchs, über den noch nicht entschieden ist, sind offen.
Das Verwaltungsgericht geht zutreffend davon aus, dass die Fahrerlaubnis nach § 3 Abs. 1 Satz 1 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) zu entziehen ist, wenn sich der Betroffene als ungeeignet oder nicht befähigt zum Führen eines Kraftfahrzeuges erweist. Gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe c StVG i. V. m. § 46 Abs. 1 Satz 2 der Verordnung über die Zulassung von Personen im Straßenverkehr (FeV) i. V. m. Nr. 9 der Anlage 4 zur FeV ist ein Kraftfahrer, der Betäubungsmittel im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes konsumiert hat, im Regelfall als ungeeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen anzusehen. Dies gilt unabhängig von der Häufigkeit des Konsums, der Höhe der Betäubungsmittelkonzentration, einer Teilnahme am Straßenverkehr in berauschtem Zustand und vom Vorliegen konkreter Ausfallerscheinungen beim Betroffenen (vgl. VGH München, Beschluss vom 28. Februar 2024 – 11 CS 23.1387 –, juris Rn. 13 m. w. N.). Im Regelfall rechtfertigt bereits die einmalige bewusste (nachgewiesene) Einnahme von „harten Drogen“ die Annahme der Nichteignung, ohne dass ein Zusammenhang zwischen dem Drogenkonsum und der Teilnahme am Straßenverkehr bestehen müsste (vgl. OVG Greifswald, Beschluss vom 22. November 2022 – 1 M 491/22 OVG –; Beschluss vom 16. Oktober 2018 – 3 M 356/18 –; Beschluss vom 24. Juni 2009 – 1 M 87/09 –, juris Rn. 5). Die eignungsausschließende Einnahme von Betäubungsmitteln setzt dabei grundsätzlich einen willentlichen Konsum voraus. Vorliegend bestreitet der Antragsteller nicht, Cocain eingenommen zu haben; er trägt jedoch vor, dass die Einnahme unbewusst erfolgt sei. Die unbewusste Einnahme von Betäubungsmitteln stellt nach allgemeiner Lebenserfahrung eine seltene Ausnahme dar. Wer sich darauf beruft, muss einen detaillierten, in sich schlüssigen und glaubhaften Sachverhalt vortragen, der einen solchen Geschehensablauf als ernsthaft möglich erscheinen lässt und der insoweit der Nachprüfung zugänglich ist. Es muss überzeugend aufgezeigt werden, dass dem Auffinden von Betäubungsmitteln im Körper eines Fahrerlaubnisinhabers Kontakt mit Personen vorausgegangen ist, die zumindest möglicherweise einen Beweggrund hatten, dem Betroffenen ein drogenhaltiges Getränk bzw. Nahrungsmittel zugänglich zu machen; ferner, dass dieser selbst die Aufnahme des Betäubungsmittels und deren Wirkung tatsächlich nicht bemerkt hat (vgl. VGH München, Beschluss vom 28. Februar 2024 – 11 CS 23.1387 –, juris Rn. 14; OVG Bautzen, Beschluss vom 19. Januar 2024 – 6 B 70/23 – juris Rn. 13; OVG Greifswald, Beschluss vom 18. Dezember 2023 – 1 M 549/23 OVG – und Beschluss vom 4. Oktober 2011 – 1 M 19/11–, juris Rn. 8 m. w. N.; OVG Magdeburg, Beschluss vom 26. Oktober 2022 – 3 M 88/22 –, juris Rn. 6; OVG Saarlouis, Beschluss vom 2. September 2021 – 1 B 196/21 –, juris Rn. 47; OVG Münster, Beschluss vom 18. September 2020 – 16 B 655/20 –, juris Rn. 4; OVG Bremen, Beschluss vom 12. Februar 2016 – 1 LA 261/15 –, juris Rn. 6; OVG Berlin, Beschluss vom 9. Februar 2015 – 1 M 67.14 –, juris Rn. 4).
Dabei dürfen die Anforderungen an das Vorbringen eines Betroffenen nicht überspannt werden. Insbesondere kann vom Betroffenen bei einem über mehrere Stunden andauernden Zeitraum keine minutengenaue Protokollierung des Geschehens abverlangt werden. Es kann aber regelmäßig selbst dann, wenn die konkrete Einnahme dem Betroffenen verborgen geblieben ist, eine möglichst detaillierte Schilderung der Vorgänge erwartet werden, in deren Rahmen es möglicherweise zu der Drogeneinnahme gekommen sein könnte (vgl. OVG Bautzen, Beschluss vom 19. Januar 2024 – 6 B 70/23 –, juris Rn. 13 m. w. N.; OVG Greifswald, Beschluss vom 18. Dezember 2023 – 1 M 549/23 OVG –; Beschluss vom 4. Oktober 2011 – 1 M 19/11–, juris Rn. 8).
Daran gemessen vermag der Senat der Einschätzung des Verwaltungsgerichts, der Antragsteller habe keine nachvollziehbaren Umstände vorgetragen, wie er unbewusst Cocain zu sich genommen haben solle, nicht zu folgen. Es kann zumindest nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dessen Angaben seien nicht hinreichend detailliert, schlüssig und glaubhaft. Das von Anfang an konsistente Vorbringen des Antragstellers lässt es als möglich erscheinen, dass es sich im Kern so verhalten haben könnte, wie vom Antragsteller geschildert.
Es würde die Anforderungen an die Darlegung einer Ausnahme von der Vermutung einer willentlichen Drogeneinnahme nach den konkreten Umständen des vorliegenden Einzelfalls überspannen, vom Antragsteller zu erwarten, detailliert anzugeben, wie es zur Einnahme des Cocains gekommen ist, insbesondere wie der Abend des 7. Mai 2023 im Detail verlaufen ist. Denn der Antragsteller wurde erst mit Schreiben vom 10. August 2023 zur beabsichtigten Entziehung der Fahrerlaubnis angehört und mit dem aus Sicht des Antragsgegners bestehenden Sachverhalt konfrontiert. Es kann nicht ernsthaft von jemandem verlangt werden, detaillierte Angaben zu einem über drei Monate zurückliegenden Tag (hier: 7. Mai 2023) zu machen, wenn – wie hier nach den Schilderungen des Antragstellers nicht der Fall – nicht besondere Umstände vorliegen, die eine höhere Erinnerungsleistung rechtfertigen würden. Das gilt erst recht, wenn die Möglichkeit einer unbewussten Einnahme von Cocain im Raum steht. Auch die Kontrolle am 8. Mai 2023 und die daraufhin erfolgten Gespräche mit seiner Ehefrau dürften daran im Wesentlichen nichts ändern. Dass der Antragsteller nicht bemerkt haben will, wie seine Ehefrau ihm das Cocain verabreicht hat, insbesondere wie sie ihm einen Teil des Cocains auf sein Geschlechtsteil aufgetragen hat, erscheint – unabhängig von der Frage, ob die Beteiligten Schlafanzüge getragen haben oder nicht – im Übrigen nicht gänzlich lebensfremd.
Dem Verwaltungsgericht ist zuzugeben, dass die eidesstattliche Versicherung der Ehefrau des Antragstellers mangels eigener detaillierter Darstellungen nicht den Anforderungen entspricht und die eidesstattliche Versicherung erst später im Verfahren vorgelegt wurde. Mit Blick auf die nach dem vermeintlichen Vorfall am 7. Mai 2023 entstandenen Spannungen zwischen den Eheleuten, die bis zu einer Trennung der Eheleute geführt haben sollen, erscheint es dem Senat nicht lebensfremd, dass der Antragsteller nicht gleich zu Beginn des behördlichen Verfahren an seine Ehefrau mit der Bitte um eine eidesstattliche Versicherung herangetreten ist.
Das Verwaltungsgericht stellt zutreffend fest, dass die Ehefrau des Antragstellers den Antragsteller einer erheblichen Gefährdung ausgesetzt hätte. Eine etwaige Naivität und der stärker werdende Wunsch nach einer Wiederbelebung des Sexuallebens der Eheleute lässt es jedoch durchaus als möglich erscheinen, dass die Ehefrau des Antragstellers ihr Vorhaben in der Hoffnung umgesetzt habe, es werde nichts Schlimmes passieren.
Soweit der Antragsgegner und das Verwaltungsgericht das Vorbringen des Antragstellers deshalb nicht für plausibel erachten, weil er einen Polizeibeamten während der Kontrolle am 8. Mai 2023 gefragt haben soll, „mal unter uns gesagt“, wie lange man warten solle, nachdem man „etwas“ konsumiert habe, bleibt die Frage, ob ein solches Gespräch stattgefunden hat, einer weiteren Aufklärung im Hauptsacheverfahren vorbehalten. Der Antragsteller bestreitet das Gespräch. Hierfür könnte sprechen, dass das Gespräch nicht im Bericht zur Kontrolle aufgeführt ist und sich der Polizeibeamte dazu erst auf Nachfrage des Antragsgegners mit E-Mail vom 21. Dezember 2023 (Bl. 145 BA A) geäußert hat. Auf der anderen Seite erscheint es nicht abwegig, dass sich der Polizeibeamte aufgrund des auffälligen Fahrzeugs des Antragstellers noch an den über sechs Monate zurückliegenden Vorfall erinnern konnte. Bei der weiteren Aufklärung im Hauptsacheverfahren dürfte ebenfalls zu berücksichtigen sein, was aus der Annahme eines solchen Gesprächs folgt. Hätte der Antragsteller tatsächlich am Vorabend der Verkehrskontrolle bewusst Cocain konsumiert, wäre es lebensfremd, wenn er dann den Polizeibeamten im Rahmen einer Verkehrskontrolle nach der Abbauzeit befragt. Das gilt gerade vor dem Hintergrund, dass der Antragsteller sowohl privat als auch beruflich auf seine Fahrerlaubnis angewiesen ist.
Der Umstand, dass das Vorbringen des Antragstellers den von ihm geschilderten Ablauf als möglich erscheinen lässt, führt vorliegend jedoch nicht dazu, dass sein Widerspruch voraussichtlich Erfolg haben wird, mit der Folge, dass seine Beschwerde Erfolg hätte und die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs wiederherzustellen wäre. Denn die weitere Aufklärung des Sachverhalts, insbesondere die Frage, ob das Gespräch zwischen dem Antragsteller und dem Polizeibeamten stattgefunden hat und was daraus folgt, sowie die Vernehmung der Ehefrau des Antragstellers und die etwaige Auswertung des Browserverlaufs des von der Ehefrau benutzten Computers/Handys, bleibt dem Hauptsacheverfahren vorbehalten. Die eidesstattliche Versicherung der Ehefrau des Antragstellers genügt hierfür schon mangels eigener detaillierter Darstellungen nicht aus. Angaben, die der Antragsgegner und auch das Verwaltungsgericht im Vorbringen des Antragstellers vermissen (zum Beispiel ein etwaiger Drogenkonsum der Ehefrau, nähere Angaben zum Kauf des Cocains), kann aufgrund der vorgetragenen Umstände nur die Ehefrau des Antragstellers machen.“
Aber:
„(2) Lässt sich demnach die Rechtmäßigkeit des Bescheides vom 19. Februar 2024 nicht hinreichend zuverlässig abschätzen, kann lediglich eine Interessenabwägung in Form einer Folgenabschätzung vorgenommen werden. Dabei sind die Folgen, die eintreten, wenn die aufschiebende Wirkung wiederhergestellt wird, die angefochtene Verfügung sich aber als rechtmäßig erweist, gegen die Folgen abzuwägen, die eintreten, wenn die aufschiebende Wirkung nicht wiederhergestellt wird, sich die Verfügung aber später als rechtswidrig erweist. Auf die betroffenen Grundrechte ist in besonderer Weise Bedacht zu nehmen (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 12. Mai 2005 – 1 BvR 569/05 -, juris Rn. 26; OVG Münster, Beschlüsse vom 19. Februar 2013 – 16 B 1229/12 –, juris Rn. 12).
Für den Antragsteller streiten neben dem Umstand, dass er aus beruflichen Gründen auf seine Fahrerlaubnis angewiesen ist (Art. 12 Abs. 1 des Grundgesetzes – GG –), sein Interesse an motorisierter Fortbewegung, eine vom Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) geschützte Rechtsposition, und seine damit verbundenen persönlichen Belange. Dem stehen die höchstwertigen Rechtsgüter, zu deren Schutz die Entziehung der Fahrerlaubnis erfolgt, nämlich vor allem Leib und Leben der übrigen Verkehrsteilnehmer, die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs an sich sowie bedeutende Sachwerte der Allgemeinheit gegenüber.
Im Ergebnis der Abwägung überwiegt das öffentliche Interesse an der Sicherheit des Straßenverkehrs das private Interesse des Antragstellers an der vorläufigen Beibehaltung seiner Fahrerlaubnis……“