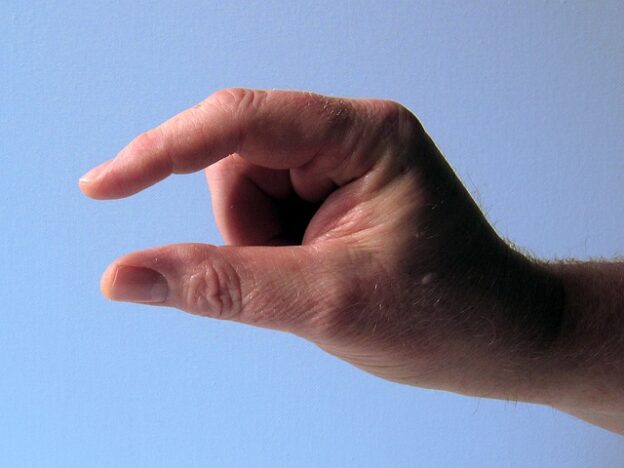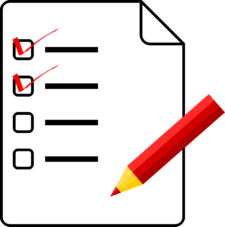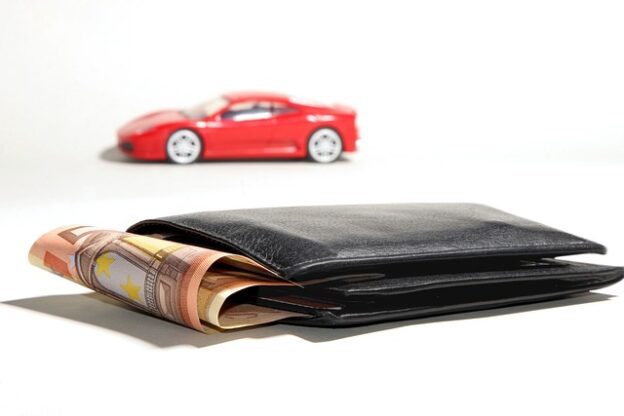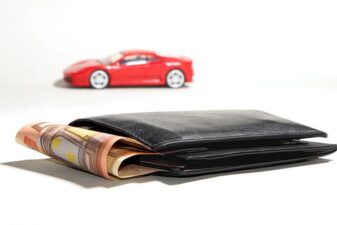Und im dritten Posting dann hier das OLG Hamm, Urt. v. 19.09.2024 – 5 ORs 37/24.
Das AG hat den Angeklagten wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in vier rechtlich zusammentretenden Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt. Im Berufungsverfahren hat das LG das Urteil dahingehend abgeändert, dass der Angeklagte wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in vier Fällen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren verurteilt wird, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.
Nach den tatsächlichen Feststellungen des LG-Urteils zündete der Angeklagte im Jahr 2022 beim Regionalligaspiel J. gegen N. anlässlich des Ausgleichstors von N. einen Knallkörper des Typs Crazy Robots (sogenannter Polenböller) in Kenntnis von dessen Gefährlichkeit und warf diesen zielgerichtet und mit Verletzungsvorsatz in Richtung der Nebenkläger. Bei den Nebenklägern handelt es sich um Ersatzspieler des N., die sich neben dem Spielfeld aufwärmten, den Athletiktrainer des Vereins sowie einen in der Nähe befindlichen Balljungen. Durch die Explosion des Knallkörpers erlitten die Nebenkläger im Einzelnen dargestellte Verletzungen, vor allem Knalltraumen, Hörstörungen und Ohrenschmerzen. Das Regionalligaspiel wurde daraufhin abgebrochen, das zuständige Sportgericht sprach dem Verein N. für das Spiel drei Punkte zu und belegte den Verein J. mit einer Geldstrafe.
Im Rahmen der Strafzumessung hat das Landgericht insbesondere ausgeführt, dass zu Gunsten des Angeklagten zwar keine Strafrahmenverschiebung nach § 46a StGB vorzunehmen sei, weil das in Aussicht gestellte Schmerzensgeld deutlich zu gering ausfalle. Der Täter-Opfer-Ausgleich sei im Rahmen der allgemeinen Strafzumessung jedoch strafmildernd zu berücksichtigen. Dagegen die Revision der StA, die Erfolg hatte:
„a) Die Strafzumessung ist grundsätzlich Sache des tatrichterlichen Ermessens und vom Revisionsgericht nur darauf zu prüfen, ob Rechtsfehler vorliegen. Das Revisionsgericht darf daher nur eingreifen, wenn die Strafzumessungserwägungen des Urteils in sich rechtsfehlerhaft sind, wenn der Tatrichter die ihm nach § 46 StGB obliegende Pflicht zur Abwägung der für und gegen den Angeklagten sprechenden Umstände verletzt, insbesondere rechtlich anerkannte Strafzwecke nicht in den Kreis seiner Erwägungen einbezogen hat, oder die Strafe bei Berücksichtigung des zur Verfügung stehenden Strafrahmens unvertretbar hoch oder niedrig ist (zuletzt OLG Hamm, Beschluss vom 19.11.2020 – III-4 RVs 129/20 -, Rn. 18, juris unter Hinweis auf die ständige Rechtsprechung des BGH; vgl. BGH, Urteil vom 27.01.2015 –1 StR 142/14 -, juris m.w.N.; s. auch: Schmitt, in: Meyer-Goßner, 67. Auflage 2024, § 337 StPO Rn. 34).
aa) Ein solcher Rechtsfehler liegt vorliegend im Hinblick auf die strafmildernde Würdigung des Täter-Opfer-Ausgleichs bzw. der Schadenswiedergutmachungsbemühungen vor.
(1) Sind durch eine Straftat – wie vorliegend mehrere Opfer betroffen – so setzt ein Täter-Opfer-Ausgleich nach ständiger Rechtsprechung voraus, dass hinsichtlich jedes Geschädigten in jedem Fall eine Alternative des § 46a StGB erfüllt sein muss (BGH, Urteil vom 12.01.2012 – 4 StR 290/11 -, juris m.w.N.). Der nach § 46a Abs. 1 Nr. 1 StGB notwendige kommunikative Prozess (vgl. hierzu: BGH, Urteil vom 11.09.2013 – 2 StR 131/13 -, Rn. 8, juris) hat nach den allein maßgeblichen Urteilsfeststellungen indes ausschließlich in der Hauptverhandlung am 21.08.2023 mit dem Nebenkläger D., nicht indes mit den weiteren, im Termin nicht anwesenden Nebenklägern stattgefunden.
(2) Soweit das Landgericht rechtsfehlerhaft den Täter-Opfer-Ausgleich bejaht hat, hat es allerdings keine Strafrahmenverschiebung vorgenommen, da das in Aussicht gestellte Schmerzensgeld deutlich zu gering bemessen sei. Vielmehr hat es die Bemühung des Angeklagten ausschließlich „im Rahmen der allgemeinen Strafzumessung“ berücksichtigt. Das Landgericht verweist damit auf die im Katalog des § 46 Abs. 2 StGB genannte Zumessungstatsache „sein Bemühen, den Schaden wiedergutzumachen“.
In den Urteilsfeststellungen werden indes keine entsprechenden Bemühungen des Angeklagten dargelegt. Nach diesen hat der Angeklagte in der Berufungshauptverhandlung lediglich eine unverbindliche Absichtserklärung abgegeben und keine konkreten Anstrengungen zur Schadenswiedergutmachung unternommen. Obgleich der Angeklagte ausweislich der Feststellungen zur Person mit seiner Familie in geregelten finanziellen Verhältnissen lebt, überdies noch von seinem Vater finanziell unterstützt wird und die Tat im Urteilszeitpunkt bereits eineinhalb Jahre zurücklag, hat er nicht an einen einzigen Geschädigten die angebotene, aber ohnehin deutlich zu geringe Schmerzensgeldzahlung geleistet. Anhaltspunkte dafür, dass der Angeklagte tatsächlich Bemühungen entfaltet, seine Ankündigung umzusetzen, sind den Urteilsfeststellungen nicht zu entnehmen.“
Die Entscheidung ist im Übrigen auch wegen der weiteren vom OLG angesprochenen Umstände von Interesse.