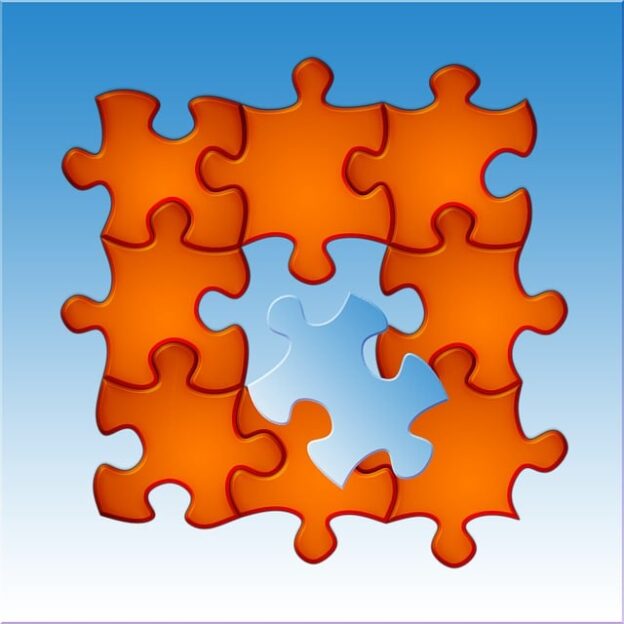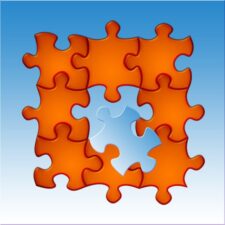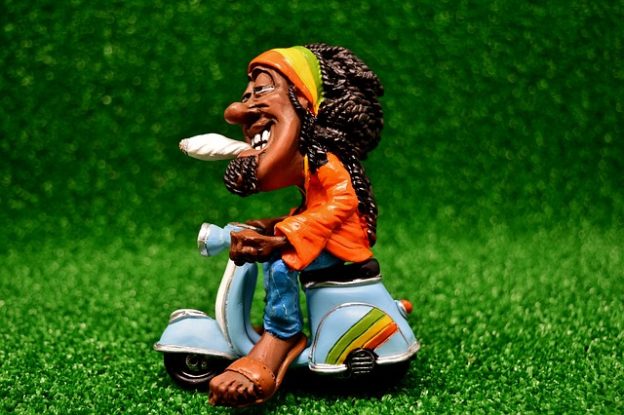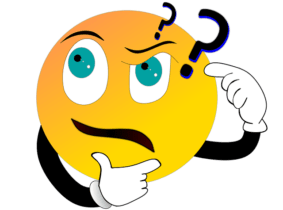Und als dritte Entscheidung stelle ich den BGH, Beschl. v. 05.12.2023 – 4 StR 421/23 – vor.
Das LG hat den Angeklagten u.a. wegen schweren sexuellen Missbrauchs „eines“ Kindes in 37 Fällen, verurteilt. Die auf die Rüge der Verletzung materiellen Rechts gestützte Revision des Angeklagten hatte Erfolg. Der BGH beanstandet die Beweiswürdigung des LG, die weise zum Tatgeschehen weist durchgreifende Darlegungsmängel auf:
„b) Das Landgericht hat seine Überzeugung von dem festgestellten Sachverhalt wie folgt begründet: Der Angeklagte habe die Taten so wie festgestellt gestanden. Sein Geständnis sei glaubhaft. Es stehe im Einklang mit der Zeugenaussage der Nebenklägerin. Die Feststellungen zu den Folgen der Taten für die Nebenklägerin seien anhand ihrer eigenen glaubhaften Angaben getroffen worden.
c) Diese Beweiserwägungen halten rechtlicher Überprüfung nicht stand.
aa) Die Beweiswürdigung ist Sache des Tatgerichts (§ 261 StPO). Ihm allein obliegt es, das Ergebnis der Hauptverhandlung festzustellen und zu würdigen. Seine Schlussfolgerungen brauchen nicht zwingend zu sein, es genügt, dass sie möglich sind. Die revisionsgerichtliche Prüfung ist darauf beschränkt, ob dem Tatgericht dabei Rechtsfehler unterlaufen sind. Dies ist in sachlich-rechtlicher Hinsicht der Fall, wenn die Beweiswürdigung widersprüchlich, unklar oder lückenhaft ist oder gegen Denkgesetze oder gesicherte Erfahrungssätze verstößt (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 2. März 2017 – 4 StR 397/16 Rn. 4; Urteil vom 22. November 2016 – 1 StR 329/16 Rn. 18; Urteil vom 12. Februar 2015 – 4 StR 420/14 Rn. 9; jeweils mwN). Dabei verpflichten §§ 261 und 267 StPO den Tatrichter, in den Urteilsgründen darzulegen, dass seine Überzeugung von den die Anwendung des materiellen Rechts tragenden Tatsachen auf einer umfassenden, von rational nachvollziehbaren Überlegungen bestimmten Beweiswürdigung beruht (vgl. BGH, Beschluss vom 11. März 2020 – 2 StR 380/19 Rn. 4 mwN). Die wesentlichen Beweiserwägungen müssen daher – über den Wortlaut des § 267 Abs. 1 Satz 2 StPO hinaus – in den schriftlichen Urteilsgründen so dargelegt werden, dass die tatgerichtliche Überzeugungsbildung für das Revisionsgericht nachzuvollziehen und auf Rechtsfehler hin zu überprüfen ist (BGH, Urteil vom 30. März 2023 – 4 StR 234/22 Rn. 12; Beschluss vom 22. November 2022 – 2 StR 262/22 Rn. 12; Beschluss vom 18. November 2020 – 2 StR 152/20).
Die sachlich-rechtliche Begründungspflicht umfasst die Verpflichtung, auch die geständige Einlassung des Angeklagten jedenfalls in ihrem wesentlichen Inhalt wiederzugeben (vgl. BGH, Beschluss vom 29. Dezember 2015 – 2 StR 322/15 Rn. 6). Denn ein Geständnis enthebt das Tatgericht nicht seiner Pflicht, es einer kritischen Prüfung auf Plausibilität und Tragfähigkeit hin zu unterziehen und zu den sonstigen Beweismitteln in Beziehung zu setzen. Erforderlich ist außerdem, dass das Tatgericht in den Urteilsgründen für das Revisionsgericht nachvollziehbar darlegt und begründet, weshalb es das Geständnis für glaubhaft erachtet. Hierbei hängt das Maß der gebotenen Darlegung von der jeweiligen Beweislage und insoweit von den Umständen des Einzelfalles ab (vgl. BGH, Urteil vom 21. März 2013 – 3 StR 247/12, BGHSt 58, 212 Rn. 14). Es steht – wie der weitere Aufklärungsbedarf (§ 244 Abs. 2 StPO) – in einer umgekehrten Wechselbeziehung zu der inhaltlichen Qualität des Geständnisses (vgl. BGH, Beschluss vom 27. Mai 2020 – 2 StR 552/19 Rn. 20; Beschluss vom 7. November 2018 – 1 StR 143/18 Rn. 7; Beschluss vom 13. September 2016 – 5 StR 338/16 Rn. 9 ff.; MüKo-StPO/Wenske, 2. Aufl., § 267 Rn. 188 ff.; s. auch BVerfG, Beschluss vom 20. Dezember 2023 – 2 BvR 2103/20 Rn. 49 ff.). Bei einem detaillierten Geständnis des Angeklagten können knappe Ausführungen genügen (vgl. BGH, Beschluss vom 24. Juli 2003 – 3 StR 368/02 Rn. 21; s. hingegen zum „Formalgeständnis“ etwa BGH, Urteil vom 26. Januar 2006 – 3 StR 415/02 Rn. 3). Decken sich die Angaben des Angeklagten mit sonstigen Beweisergebnissen und stützt der Tatrichter seine Überzeugung von der Glaubhaftigkeit des Geständnisses auch auf diese Beweisergebnisse, so ist er zu deren jedenfalls gedrängter Wiedergabe verpflichtet, da anderenfalls eine revisionsgerichtliche Überprüfung seiner Überzeugungsbildung nicht möglich ist (vgl. BGH, Beschluss vom 29. Dezember 2015 – 2 StR 322/15 Rn. 6).
bb) Den sich hieraus ergebenden Darlegungsanforderungen werden die Urteilsgründe nicht gerecht. Die Strafkammer teilt schon den wesentlichen Inhalt der Einlassung des Angeklagten nicht mit, von dem die weiteren Anforderungen an die Überzeugungsbildung und deren Darlegung in den schriftlichen Urteilsgründen abhingen. Es bleibt unklar, ob er in eigenen Worten ein detailliertes Geständnis hinsichtlich der insgesamt 132 Taten, begangen im Zeitraum von 2011 bis 2019, abgelegt und Nachfragen beantwortet oder etwa pauschal – ggf. über eine von ihm bestätigte Verteidigererklärung – die gegen ihn erhobenen Vorwürfe als zutreffend bezeichnet hat. Eine auch nur gedrängte Wiedergabe des Inhalts des Geständnisses ist den Urteilsgründen nicht zu entnehmen. Die zusammenfassende Wertung, der Angeklagte habe die Taten „so wie festgestellt“ gestanden, genügt hierfür nicht. Denn sie lässt den inhaltlichen Gehalt der Einlassung selbst nicht erkennen. Auch eine (nachvollziehbare) Bewertung des Geständnisses für sich genommen enthalten die Urteilsgründe nicht.
An die weitere Überprüfung des Geständnisses sind zwar geringere Anforderungen zu stellen, wenn es mit Angaben des Tatopfers übereinstimmt und das Tatgericht diese Angaben nachvollziehbar für glaubhaft erachtet. Hieran fehlt es aber. Die Urteilsgründe teilen den wesentlichen Inhalt der Zeugenaussage der Nebenklägerin auch nicht gedrängt mit. Die Glaubhaftigkeit dieser Aussage wird zudem nur pauschal behauptet, vom Landgericht jedoch nicht mit beweiswürdigenden Erwägungen begründet. Dessen Überzeugungsbildung vermag der Senat daher nicht zu überprüfen.
Darüber hinaus lassen die Urteilsgründe nachvollziehbare Erwägungen vermissen, aus welchen Gründen sich die Strafkammer von den Zeitpunkten und der Anzahl der abgeurteilten Taten überzeugt hat. Die Tatzeiten sind dabei mit Blick auf das jeweilige Alter der Geschädigten für die Anwendbarkeit der von der Strafkammer herangezogenen Straftatbestände der § 176 Abs. 1, § 176a Abs. 2 Nr. 1 und § 184b Abs. 1 Nr. 3 StGB aF entscheidend. Von dem Alter der Nebenklägerin hängt auch der Schuldspruch im Fall 131 der Urteilsgründe ab, in dem das Landgericht neben einer Vergewaltigung tateinheitlich den schweren sexuellen Missbrauch von Kindern bejaht hat. Zu näheren Beweiserwägungen hierzu musste sich das Landgericht mit Blick auf die Vielzahl und Komplexität der Tatvorwürfe und das naheliegend nur noch eingeschränkte Erinnerungsvermögen des geständigen Angeklagten an Einzelheiten des Tatgeschehens gedrängt sehen (vgl. BGH, Beschluss vom 6. Juli 2022 – 2 StR 53/22 Rn. 11; Beschluss vom 13. September 2016 – 5 StR 338/16 Rn. 9 mwN). Nach den Feststellungen beging er eine Vielzahl der abgeurteilten Taten serienhaft und vor langer Zeit. Zusätzlich überlagerten sich verschiedene sexuelle Handlungen (Berührungen, Oralverkehr) in zeitlicher Hinsicht. Ist – wie hier – eine Individualisierung einzelner Taten mangels Besonderheiten im Tatbild oder der Tatumstände nicht möglich, sind zumindest die Anknüpfungspunkte zu bezeichnen, anhand derer das Tatgericht den Tatzeitraum eingegrenzt hat und auf die sich seine Überzeugung von der Mindestzahl und der Begehungsweise der Missbrauchstaten in diesem Zeitraum gründet (vgl. BGH, Urteil vom 27. Januar 2022 – 3 StR 74/21 Rn. 13; Beschluss vom 20. Juni 2001 – 3 StR 166/01 Rn. 7). Hieran fehlt es. Das Landgericht hätte näher darlegen müssen, aufgrund welcher Beweisumstände es von den festgestellten Tatzeiträumen und der in den Fällen 1-93 und 95-130 abgeurteilten Mindestanzahl von Taten überzeugt war. Zugleich hätte die Strafkammer auf diesem Hintergrund ihre Beweiserwägungen darstellen müssen, die die Einbettung der Einzelfälle 94, 131 und 132 in das Gesamtgeschehen und damit das hier jeweils festgestellte Alter der Nebenklägerin tragen.“
Ich verstehe es nicht. Wenn ich schon lese: „Die Strafkammer teilt schon den wesentlichen Inhalt der Einlassung des Angeklagten nicht mit, von dem die weiteren Anforderungen an die Überzeugungsbildung und deren Darlegung in den schriftlichen Urteilsgründen abhingen.“ Und das bei einer großen Strafkammer. Da sollte man doch davon ausgehen können, dass zumindest der Vorsitzende weiß, wie man eine vernünftige Beweiswürdigung macht. Offenbar ist das aber nicht der Fall. Zumindest hier nicht…..