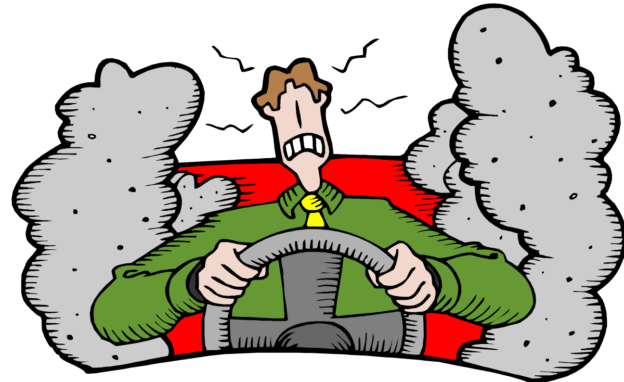Und heute dann OWi, und zwar zweimal OLG und einmal AG.
Und heute dann OWi, und zwar zweimal OLG und einmal AG.
Ich beginne mit dem OLG Stuttgart, Beschl. v. 15.01.2024 – 2 ORbs 23 Ss 769/23. Das OLG hat sich mit der Frage des Strafklageverbrauchs (Art. 103 Abs. 3 GG) auseinandersetzt in einem Fall, in dem dem Betroffenen zwei zeitlich nahe beieinander liegende Geschwindigkeitsüberschreitungen zur Last gelegt worden sind.
Das AG hat den Betroffenen wegen vorsätzlicher Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften, begangen am 27.10.2022 um 21.34 Uhr auf der B 27 zwischen Ludwigsburg und Kornwestheim verurteilt. Dort war die Geschwindigkeit auf 80 km/h beschränkt, der Betroffene hatte die Kontrollstelle mit einer Geschwindigkeit von 151 km/h passiert. Das AG hat zudem festgestellt, dass gegen den Betroffenen bereits am 9.12.2022 – rechtskräftig seit 29.12.2022 – eine Geldbuße von 180 € festgesetzt worden, weil er ebenfalls am 27.10.2022 um 21:34 Uhr innerhalb Ludwigsburgs auf der Stuttgarter Straße in Fahrtrichtung Stuttgart auf Höhe des Ortsschilds die dort zulässige Geschwindigkeit von 50 km/h um 30 km/h überschritten hat.
Die gegen die Verurteilung gerichtete Rechtsbeschwerde des Betroffenen hatte Erfolg:
„Das vorliegende Verfahren ist – unter klarstellender Aufhebung des angefochtenen Urteils – durch Beschluss gemäß § 79 Abs. 3 OWiG i. V. m. §§ 354 Abs. 1, 206 a StPO einzustellen, weil die auch in der Rechtsbeschwerdeinstanz von Amts wegen vorzunehmende Prüfung der Verfahrensvoraussetzungen ergeben hat, dass der Verfolgung der dem Betroffenen, in diesprrj.V9rfghrqn zur, Last gelegten Tat ein Verfahrenshindernis entgegensteht.
1. Der aus dem Fahreignungsregister ersichtliche – rechtskräftige Bußgeldbescheid der Stadt Ludwigsburg vom 9. Dezember 2022 entfaltet nach dem Grundsatz aus Art. 103 Abs. 3 GG eine Sperrwirkung, welche die Verfolgung des dem Betroffenen in diesem Verfahren zur Last gelegten Tatvorwurfes ausschließt. Die den Gegenstand des vorliegenden Bußgeldverfahrens bildende Tat ist im verfahrensrechtlichen Sinn identisch mit der Tat, die mit Bußgeldbescheid des Stadt Ludwigsburg vom 9. Dezember 2022 wegen Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit innerhalb geschlossener Ortschaften zur Last gelegt worden ist und wegen der gegen den Betroffenen – rechtskräftig – eine Geldbuße von 180 € festgesetzt worden ist. Die – unzulässigerweise – in zwei gesonderten Bußgeldverfahren verfolgten Verkehrsverstöße stellen sich verfahrensrechtlich als eine Tat L S. des § 264 StPO dar.
Der Begriff der Tat im gerichtlichen Verfahren in Bußgeldsachen deckt sich mit dem für das Strafverfahren maßgeblichen Tatbegriff des Art. 103 Abs. 3 GG (vgl. BayObLGSt 1974, 58 f.; 2001, 134 f.). Er bezeichnet ein konkretes Geschehen, das einen einheitlichen geschichtlichen Vorgang bildet und Merkmale enthält, die es von denkbaren anderen ähnlichen oder gleichartigen Vorkommnissen unterscheidet und umfasst das gesamte Verhalten des Täters, soweit dieses nach der natürlichen Auffassung des Lebens eine Einheit bildet (vgl. BayObLGSt 2001, 134 f.; OLG Hamm, Beschluss vom 09.06.2009 – 5 Ss OWI 297/09 -; Meyer-Goßner, StPO, 66. Aufl., § 264 Rdnr. 2 f.). Dabei können auch mehrere, materiell-rechtlich tatmehrheitlich begangene Handlungen als eine Tat i. S. des § 264 StPO anzusehen sein, wenn die einzelnen Handlungen nach dem Ereignisablauf zeitlich, räumlich und innerlich so miteinander verknüpft sind, dass sich ihre getrennte Würdigung und Ahndung als unnatürliche Aufspaltung eines einheitlichen Lebensvorganges darstellen würde (vgl. OLG Hamm a. a. 0.; BayObLGSt 2001, 134 f.; BVerfGE 45, 434 f.; BGHSt 23, 141 f.; Meyer-Goßner a. a. O.).
Allerdings stellen sich nicht alle Vorgänge, die sich auf einer Fahrt ereignen, als einheitlicher Lebenssachverhalt dar. In der Rechtsprechung der Obergerichte ist anerkannt – von Ausnahmen abgesehen -, dass verschiedene auf einer Fahrt begangene Ordnungswidrigkeiten nicht schon dadurch zu einer prozessualen Tat zusammengefasst werden, dass sie auf derselben Fahrt begangen worden sind. Vielmehr ist mit dem Ende eines bestimmten Verkehrsvorganges, der durch einen anderen abgelöst wird, in der Regel das die Tat bildende geschichtliche Ereignis abgeschlossen (vgl. OLG Düsseldorf, VRS 67, 129, VRS 71, 375, VRS 75, 360; BayObLG NZV 1994, 448; OLG Köln, NZV 1994, 292; OLG Hamm, DAR 1974, 22).
Die maßgebliche Beurteilung, ob ein bestimmter Verkehrsvorgang abgeschlossen ist, ist Tatfrage. Entscheidend für die Beurteilung sind jeweils die Umstände des Einzelfalles. Erst unter Bewertung dieser Umstände ist im Einzelfall einzuschätzen, ob nach der „natürlichen Auffassung des Lebens“ mehrere Verstößen demselben Verkehrsvorgang zuzuordnen sind und damit eine einheitliche Tat im verfahrens-rechtlichen Sinne vorliegt.
Maßgeblich sind für die Beurteilung insbesondere der zeitliche und räumliche Zusammenhang zwischen den Verkehrsverstößen und die zugrunde liegende Pflichtenlage in Bezug auf den konkreten Verkehrsverstoß. Wichtiges Kriterium für die Verneinung oder Bejahung eines einheitlichen Tatgeschehens ist auch die Frage, ob beide Verkehrsverstöße in subjektiver Hinsicht auf der gleichen Willensrichtung des Betroffenen beruhen (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 25.10.2011, NZV 2012. 196 f. m.w.N.).
Legt man diese Maßstäbe bei der Beurteilung des vorliegenden Falles zugrunde, ergibt sich Folgendes:
Beide Vorgänge sind zeitlich aufs Engste verknüpft. Den Feststellungen ist zu entnehmen, dass der Betroffene am 27. Oktober 2022 um 21:34 Uhr das Ortsschild am Ausgang der Stadt Ludwigsburg in Fahrtrichtung Kornwestheim passierte und in der selben Minute, also – da die Tatzeiten nur nach Minuten und nicht auch nach Sekunden festgestellt worden sind – maximal 59 Sekunden später, in gleicher Fahrtrichtung die Messstelle nach der Abfahrt Autokino.
Beide Vorgänge sind demselben Verkehrsvorgang zuzuordnen, nämlich dem (pflichtwidrig stark beschleunigten) Geradeausfahren zwischen den Messstellen. Eine Änderung dieses beschleunigten Geradeausfahrens ist nicht ersichtlich. Lediglich die äußere Situation, nämlich die geltende Geschwindigkeitsregelung, änderte sich. Die beiden Verkehrsverstöße sind auch in subjektiver Hinsicht eng miteinander verbunden, denn beide Geschwindigkeitsverstöße beruhen bei Betrachtung der gemessenen Geschwindigkeiten und der zurückgelegten Wegstrecke ersichtlich auf dem Willen des Betroffenen, den Verkehrsvorgang des Geradeausfahrens möglichst schnell abzuschließen. Dass der Betroffene in Umsetzung dieses Willens ohne weitere Fahrmanöver ab dem ersten Geschwindigkeitsverstoß weiter beschleunigt hat, drängt sich auf.
Der von der Generalstaatsanwaltschaft dargelegten zwischenzeitlichen (rechtlichen) Veränderung der Verkehrssituation kommt in diesem Fall angesichts des äußerst engen zeitlichen und auch räumlich relativ engen Zusammenhangs und des verbindenden subjektiven Elementes keine durchgreifende Bedeutung zu.“
Geht man davon aus, dass dem Betroffenen auch bei der ersten Geschwindigkeitsüberschreitung um „nur“ 30 km/h ebenfalls Vorsatz vorzuwerfen ist, wovon beim Maß der Geschwindigkeitsüberschreitung auszugehen ist, dann dürfte die Entscheidung zutreffend sein. Der Betroffene, offenbar ein „Raser“, kommt dann mit einem blauen Auge davon, das das AG wegen der zweiten Geschwindigkeitsüberschreitung eine Geldbuße von 1.500 EUR festgesetzt und eine Fahrverbot von drei Monaten verhängt hat. Schwieriger könnte es werden, und das hätte ich als OLG vom AG aufklären lassen, wenn man dem Betroffenen beim ersten Vorwurf nur Fahrlässigkeit zur Last gelegt hat. Denn dann stellt sich die Frage, ob in dem weiteren „(pflichtwidrig stark beschleunigten) Geradeausfahren zwischen den Messstellen“ zwischen den Messtellen wegen der nun vorsätzlichen Begehungsweise nicht eine neue Tat liegt, die gesondert geahndet werden kan.