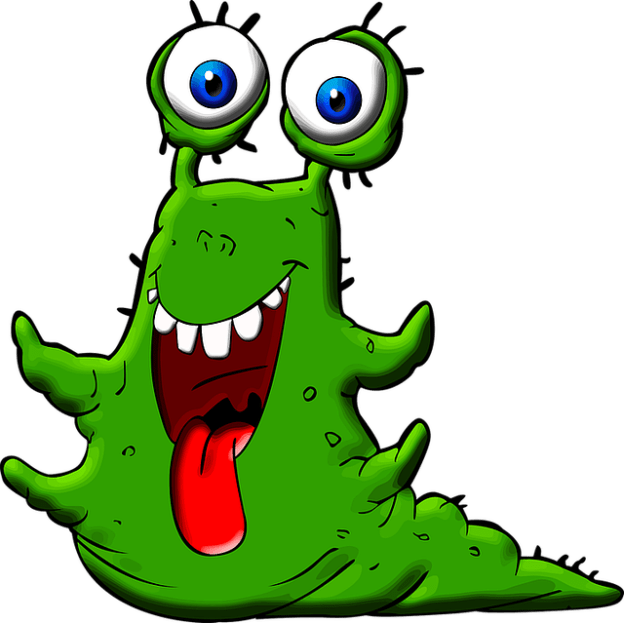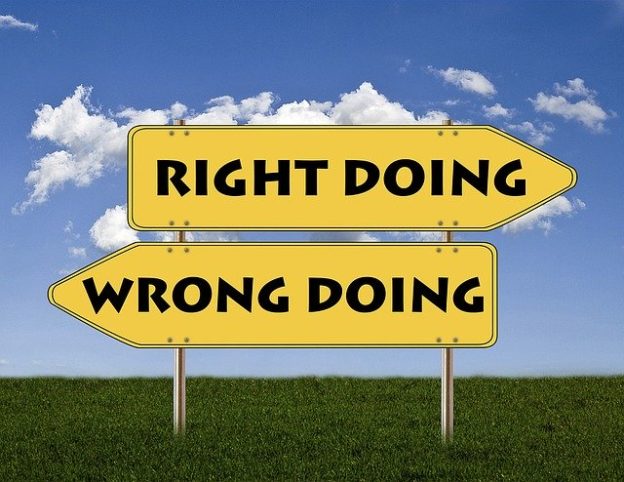Als zweites dann der BayObLG, Beschl. v. 04.06.2024 – 203 StRR 184/24. Das ist mal wieder so eine Entscheidung, bei der man die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und rufen möchte: „Das kann doch nicht wahr sein.“ Das bezieht sich allerdings nicht aus den BayObLG-Beschluss, sondern aus das landgerichtliche Berufungsurteil, das grob fehlerhaft ist/war. Daher was bei mir die Entscheidung des BayObLg auch mit dem Zusatz „viele Fehler“ gespeichert.
In der Sache geht es um eine Verurteilung wegen eines Ladendiebstahls. Die beanstandet das BayObLG. Ich stelle hier, weil es sonst zu viel wird, nur die Ausführungen des BayObLG zu den insoweit tatsächlichen Feststellungen vor – und verweise noch einmal darauf: Es handelte sich um ein Urteil einer Berufungskammer:
„1. Die Feststellungen des Landgerichts genügen nicht, um eine Verurteilung des Angeklagten wegen vollendeten Diebstahls zu tragen. Das Landgericht hat außer Acht gelassen, dass die in den Urteilsgründen gewählte Formulierung „entwendete“ ohne nähere Darlegung der Vorgehensweise des Täters nicht den Anforderungen der Rechtsprechung an die Darstellung eines vollendeten Diebstahls in einem Ladengeschäft genügt.
a) Der Begriff des Entwendens lässt offen, wie sich die Tat abgespielt hat und ob die Wegnahme im Rechtssinne vollendet wurde (St. Rspr., vgl. Senat, Beschluss vom 19. Juli 2023 – 203 StRR 255/23 -, unveröffentlicht; BayObLG, Beschluss vom 7. April 2021 — 202 StRR 33/21 —, juris; KG Berlin, Beschluss vom 23. Oktober 2019 — 3 Ss 89/19 —, juris Rn. 8 ff.; OLG Dresden, Beschluss vom 12. März 2015 — 2 OLG 22 Ss 14/15 —, juris; OLG Hamm, Beschluss vom 14. November 2013 – 111-5 RVs 111/13 juris; OLG Hamm, Beschluss vom 6. Mai 2013 – 111-5 RVs 38/13 juris; Quentin in MüKo-StPO, 2. Aufl., § 318 Rn. 39). Für eine vollendete Wegnahme ist erforderlich, dass der Täter hinsichtlich der zuzueignenden Sache fremden Gewahrsam gebrochen und neuen begründet hat (St. Rspr., vgl. etwa BGH, Urteil vom 6. März 2019 – 5 StR 593/18-, juris m.w.N.; Schmitz in MüKo-StGB, 4. Aufl. § 242 Rn. 83 ff.; Bosch in Schönke/Schröder, StGB, 30. Aufl., § 242 Rn. 37 ff.; Fischer, StGB, 71. Aufl., § 242 Rn. 16 ff.). Für die Frage des Wechsels der tatsächlichen Sachherrschaft bei einem Ladendiebstahl ist entscheidend, dass der Täter diese derart erlangt, dass er sie ohne Behinderung durch den alten Gewahrsamsinhaber ausüben kann und dieser über die Sache nicht mehr verfügen kann, ohne seinerseits die Verfügungsgewalt des Täters zu brechen (BGH, Urteil vom 6. März 2019 — 5 StR 593/18 —, juris Rn. 3). Maßgeblich sind stets die Umstände des Einzelfalls (vgl. zu den möglichen Fallkonstellationen beim Ladendiebstahl Vogel/Brodowski in: Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Aufl., § 242 Rn. 100 ff.; Bosch a.a.O. Rn. 39). Allein der Umstand, dass die Sache zurückgegeben wurde, lässt noch keinen verlässlichen Schluss auf die Begründung von Gewahrsam von Seiten des Täters zu (vgl. BayObLG, Beschluss vom 7. April 2021 a.a.O. Rn. 5). Entsprechendes gilt für die Feststellung der gewerbsmäßigen Begehungsweise. Weder der Verweis auf ein Geständnis des Angeklagten noch die Darlegung seiner Absicht kann die fehlenden Ausführungen zu den Gewahrsamsverhältnissen kompensieren (zum Geständnis vgl. Senat a.a.O.; OLG Hamm, Beschluss vom 14. November 2013 – III-5 RVs 111/13 -, juris Rn. 9; OLG Hamm, Beschluss vom 6. Mai 2013 — III-5 RVs 38/13 juris).
b) Auch die in den Urteilsgründen nach § 267 Abs. 1 Satz 3 StPO erfolgte Bezugnahme auf mehrere Lichtbilder, die die entwendeten Parfums zeigen, vermag die fehlenden Feststellungen nicht zu ersetzen. Nach § 267 Abs. 1 §. 1 und §. 3 StPO müssen die Urteilsgründe im Falle einer Verurteilung die für erwiesen erachteten Tatsachen angeben, in denen die gesetzlichen Merkmale der Straftat gefunden werden; wegen der Einzelheiten kann auf Abbildungen, die sich bei den Akten befinden, verwiesen werden. Satz 3 der Vorschrift gestattet jedoch nur die ergänzende Heranziehung von Abbildungen, nicht jedoch eine Verweisung auf ein Schriftstück, soweit es auf den Wortlaut ankommt (BGH, Urteil vom 20. Oktober 2021 — 6 StR 319/21 juris Rn. 10; BGH, Urteil vom 20. Januar 2021 —2 StR 242/20 —, juris Rn. 19, 21). Da der Tatrichter nur auf die – eine Wegnahme nicht belegenden – Lichtbilder verwiesen hat, könnte der Senat aus den Abbildungen einen Gewahrsamsbruch nicht ableiten. Dass auch ein außerhalb der Lichtbilder befindlicher Text Gegenstand der Inaugenscheinnahme gewesen wäre und vom Gericht und den Beteiligten wahrgenommen worden ist, lässt sich den Ausführungen im Urteil nicht entnehmen. Der Senat darf daher die Bildunterschrift in der Revision nicht zur Kenntnis nehmen. Auf die in der Rechtsprechung nicht endgültig geklärte Frage, inwieweit ein Text innerhalb einer Abbildung von der Regelung des § 267 Abs. 1 §. 3 StPO erfasst ist (vgl. BayObLG5 Beschluss vom 31 . Januar 2022 – 202 ObOWi 106/22 juris; KG, Beschluss vom 23. April 2021BeckRS 2021, 12952; BeckOK StPO/Peglau, 51. Ed. 1.4.2024, StPO § 267 Rn. 9; Bartel in KK-StPO, 9. Aufl., § 267 Rn. 43), kommt es daher nicht an.“
Den Rest dann bitte selbst lesen. Hier müssen die Leitsätze dann reichen, und twar.
-
- Die Formulierung „entwendete“ in den Urteilsgründen ohne nähere Darlegung der Vorgehensweise des Täters genügt nicht den Anforderungen der Rechtsprechung an die Darstellung eines vollendeten Diebstahls in einem Ladengeschäft.
- § 267 Abs. 1 Satz 3 StPO gestattet nur die ergänzende Heranziehung von Abbildungen, nicht jedoch eine Verweisung auf ein Schriftstück, soweit es auf den Wortlaut ankommt.
- Bei der Schuldfähigkeitsbeurteilung hat der Tatrichter zwischen der Einsichts- und der Steuerungsfähigkeit zu differenzieren.
- In Fällen einer Kumulation von Alkohol und Betäubungsmitteln ist in der Regel die Hinzuziehung eines Sachverständigen sachdienlich.