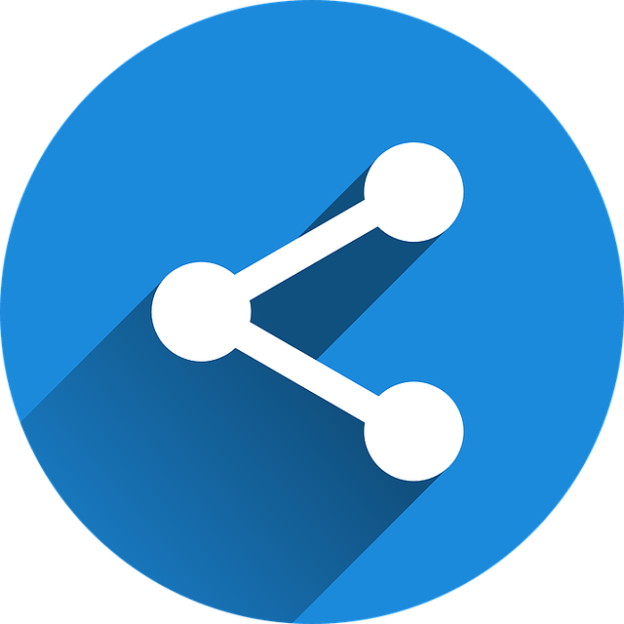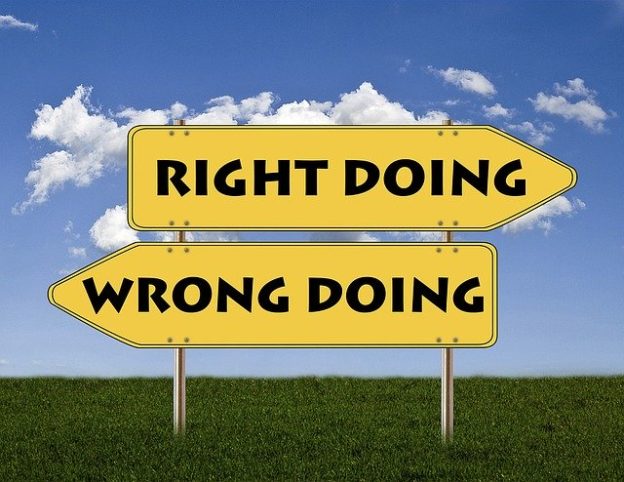Das LG hat die Eröffnung des Hauptverfahrens, in dem dem Angeklagten insgesamt fünf Tatkomplexe zur Last gelegt worden sind, u.a. mit der Begründung abgelehnt, weil die aus der Überwachung des Chatverkehrs des Angeklagten gewonnenen Erkenntnisse aus dem Messenger-Dienst SkyECC nach Inkrafttreten des KCanG nicht mehr verwertbar seien. Die dagegen gerichtete sofortige Beschwerde der StA hatte keinen Erfolg:
„Die Eröffnung des Hauptverfahrens ist zu beschließen, wenn nach den Ergebnissen des vorbereitenden Verfahrens der Angeschuldigte einer Straftat hinreichend verdächtig erscheint (§ 203 StPO). Hinreichende Tatverdacht ist anzunehmen, wenn die nach Maßgabe des Akteninhalts vorzunehmende vorläufige Tatbewertung ergibt, dass die Verurteilung des Angeschuldigten wahrscheinlieh ist (Senat, Beschl. v. 21.07.2005 — 3 Ws 165/04, BeckRS 2005, 33531, beck-online). Auf diese Verdachtsprognose in Gestalt der strafprozessualen Reproduzierbarkeit der im Ermittlungsverfahren erarbeiteten Erkenntnisse in der Hauptverhandlung können auch Beweisverwertungsverbote Einfluss gewinnen (vgl.. BGH, Beschl. v. 01.12.2016 — 3 StR 230/16, NStZ 2017, KK-StPO/Schneider, 9. Aufl. 2023, StPO § 203 Rn. 9 m.w.N.).
Gemessen hieran besteht hinsichtlich der dem Angeschuldigten in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Mannheim vom 08.03.2024 vorgeworfenen Tat Ziff. 2 keine Verurteilungswahrscheinlichkeit Das dem Angeschuldigten diesbezüglich zur Last gelegte Cannabisgeschäft lässt sich, wie im Sonderband „Fallakte 7″ ausführlich und überzeugend dargestellt, in tatsächlicher Hinsicht ohne weiteres aus dem Inhalt der über Kryptohandys des Anbieters SkyECC mit den Kennungen „K 1″ und „K 2“ ausgetauschten Nachrichten ableiten; welche von französischen Ermittlungsbehörden in einem dort geführten Verfahren erhoben und an die Staatsanwaltschaft Mannheim im Wege einer Europäischen Ermittlungsanordnung übermittelt wurden. Weitere einen Verdacht begründende Erkenntnisse liegen hingegen nicht vor.
Allerdings besteht hinsichtlich dieser Inhalte nach Inkrafttreten des Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit Cannabis und zur Änderung weiterer Vorschriften (Cannabisgesetz — CanG) vom 27.03.2024 (BGBl I, 2024 Nr. 109) am 01.04.2024 ein Beweisverwertungsverbot.
Gesetzliche Rechtsgrundlage für die Verwertung von in einer Hauptverhandlung zu erhebenden Beweisen ist § 261 StPO und zwar unabhängig davon, ob diese zuvor im Inland oder auf sonstige Weise – etwa im Wege der Rechtshilfe – erlangt worden sind. Denn die Frage, ob im Wege der Rechtshilfe erlangte Beweise verwertbar sind, richtet sich ausschließlich nach dem nationalen Recht des um Rechtshilfe ersuchenden Staates, soweit – wie hier – der um Rechtshilfe ersuchte Staat die unbeschränkte Verwendung der von ihm erhobenen und übermittelten Beweisergebnisse gestattet hat (vgl. BGH, Beschluss vom 02.03.2022 — 5 StR 457/21 —, juris, Rn. 25 ff.). Da die in Grundrechte eingreifende Ermittlungsmaßnahmen anders als bei inneren oder im Wege der europäischen Rechtshilfe ersuchten ausländischen Ermittlungsmaßnahmen nicht schon bei deren Anordnung, etwa durch Beschränkung auf besonders schwere Straftaten oder Fälle qualifizierten Verdachts, limitiert werden können, sind die dadurch möglichen Unterschiede bei den Eingriffsvoraussetzungen auf der Ebene der Beweisverwendung zu kompensieren. Hierfür kann auf die in strafprozessualen Verwendungsbeschränkungen verkörperten Wertungen zurückgegriffen werden, mit denen der Gesetzgeber dem verfassungsrechtlichen Verhältnismäßigkeitsgrundsatz bei vergleichbar eingriffsintensiven Mitteln Rechnung trägt (vgl. BGH, Beschluss vom 02.03.2022, aaO., Rn. 68). Zur Verwertung von Daten von Nutzern des Kommunikationsdienstes EnchroChat, die von französischen Ermittlungsbehörden auf Grundlage einer Europäischen Ermittlungsanordnung übermittelt wurden, hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass hinsichtlich der Frage der Verwertbarkeit die Vorschrift des § 100e Abs. 5 StPO nach ihrem Wortlaut nicht ausdrücklich angewendet werden kann, da die in Rede stehenden Daten nicht durch Maßnahmen nach den §§ 100b, 100c StPO, sondern durch eigenständige Maßnahmen nach französischem Prozessrecht gewonnen wurden. Allerdings können aufgrund des Gewichts der Maßnahme zur Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes – auch um jede Benachteiligung auszuschließen – die Grundgedanken des § 100e Abs. 6 StPO als Verwendungsschranke mit dem höchsten Schutzniveau fruchtbar gemacht werden (vgl. BGH Beschluss vom 02.03.2022 — 5 StR 457/21, aaO., Rn. 65 f.). Daraus folgt, dass eine Beweisverwertung von Erkenntnissen aus dem Kernbereich privater Lebensführung stets unzulässig ist (vgl. auch § 100d Abs. 2 Satz 1 StPO) und darüber hinaus nach der Wertung des § 100e Abs. 6 Nr. 1 StPO die im Wege europäischer Rechtshilfe erlangten Beweisergebnisse aus dem EncroChat-Komplex in einem Strafverfahren ohne Einwilligung der überwachten Person nur zur Aufklärung einer Straftat, auf Grund derer eine Maßnahme nach § 100b StPO hätte angeordnet werden können, oder zur Ermittlung des Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person verwendet werden dürfen. Hierbei sind auch die den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz konkretisierenden einschränkenden Voraussetzungen in § 100b Abs. 1 Nr. 2 und 3 StPO in den Blick zu nehmen, wonach die Straftat auch im Einzelfall besonders schwer wiegen und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsorts auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos sein muss (vgl. BGH Beschluss vom 02.03.2022 — 5 StR 457/21, aaO, Rn. 68-69). Für die Prüfung, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist auf den Zeitpunkt der Beweisergebnisse abzustellen (BGH, Beschluss vom 02.03.2022 — 5 StR 457/21, aaO, Rn. 70).
Dieselben Maßstäbe gelten – da sich die Rahmenbedingungen für die Datenerhebung in Frankreich und die Übermittlung der Daten im Wege einer Europäischen Ermittlungsanordnung nicht wesentlich unterscheiden – auch für die Verwertung von im Wege. europäischer Rechtshilfe erlangter Beweisergebnisse hinsichtlich des Krypto-Messengers SkyECC. Ebenso wie die Encro-Chat-Daten sind diese in einem französischen Ermittlungsverfahren erhoben worden und auch die wesentlichen Rahmenbedingungen stimmen zwischen den beiden Anbietern überein. lnsbesondere befand sich – ausweislich der vorliegenden Beschlüsse des in beiden Fällen zuständigen Gerichts in Lille – bei beiden Anbietern der Server, über den die Kommunikation erfolgte, an einem Standort in Roubaix und das Angebot sowohl von Encrochat als auch von SkyECC war dadurch gekennzeichnet, dass die Geräte nicht über legale Vertriebswege verkauft wurden und für die verschlüsselten Geräte ein außergewöhnlich hoher Preis — etwa 1.500 Euro für eine sechsmonatige Nutzung – zu zahlen war, obwohl die Geräte selbst nur über einen sehr eingeschränkten Funktionsumfang verfügten (vgl. OLG Celle, Beschluss vom 15.11:2021 — 2 HEs 24 – 30/21 -, Rn. 23, juris).
Gemessen an den genannten Grundsätzen wäre eine Verwertbarkeit der über den Krypto-Messenger SkyECC erlangten Erkenntnisse nur dann zu bejahen, wenn die betreffenden Taten im Verwertungszeitpunkt noch den Anforderungen des § 100b StPO genügten, insbesondere wenn sie auch nach Inkrafttreten des CanG noch Katalogtaten im Sinne des § 100b Abs. 2 StPO darstellten (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 06.06.2024 – 2 Ws 251/24 -, n.v.; KG Berlin, Beschluss s 67/24 – 121 GWs 38/24 juris zu EncroChat; OLG Stuttgart, Beschluss Ws 123/24 – Burhoff online zu Anom).
Im hier zu entscheidenden Fall unterfällt die dem Angeschuldigten in der Anklageschrift vom 08.04.204 zur Last gelegte Tat Ziff. 2, die alleine die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Mannheim nach § 7 StPO begründen könnte, nach dem zum 01.04.2024 als Art. 1 CanG in Kraft getretenen KCanG nicht mehr dem BtMG, sondern ist als Handeltreiben mit Cannabis in Tateinheit mit Einfuhr von Cannabis, gemäß §§ 1 Nr. 8, 2 Abs. 1 Nr. 4 und 5, 34 Abs. 1 Nr. 4 und 5 KCanG zu werten, wobei die Tat eine nicht geringe Mengen Cannabis betrifft und aufgrund der erheblichen Mengen und des Marktwerts eine gewerbsmäßige Begehungsweise nahe liegt, weshalb die Tat einen besonders schwereren Fall gemäß § 34 Abs. 3 Nr. 1 und 4 KCanG darstellt. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Tat einen Verbrechenstatbestand des § 34 Abs. 4 KCanG erfüllt, sind nicht gegeben.
Durch Art. 13a des CanG wurden zeitgleich mit Inkrafttreten des KCanG strafprozessuale Befugnisnormen, u.a. auch § 100b StPO, geändert. Nach § 100b Abs. 2 Nr. 5a StPO in der ab dem 01.04.2024 gültigen Fassung sind schwere Straftaten im Sinne des § 100b Abs. 1 Nr. 1 StPO die Verbrechenstatbestände des § 34 Absatz 4 Nr. 1, 3 oder 4 KCanG. Zu dem maßgeblichen Verwendungszeitpunkt – also der Verwertung der Erkenntnisse im Zwischen- und Hauptverfahren – lag demnach keine Katalogtat im Sinne des § 100b Abs. 2 Nr. 5a StPO mehr vor, weshalb die Verwertbarkeit der Daten ausscheidet und diese zur Begründung des hinreichenden Tatverdachts nicht mehr herangezogen werden können (vgl. OLG Köln aaO.; KG aaO.; OLG Stuttgart aaO).
Soweit im Hinblick auf die Verwertung von im Ausland erhobenen und nach Deutschland zum Zwecke der StrafverfoIgung übermittelten Daten von Krypto-Messengem vertreten wird, für die Frage der Verwertbarkeit sei allein auf den Zeitpunkt der Erhebung abzustellen, da rechtliche Veränderungen ebenso zu behandeln seien wie Veränderungen der Verdachtslage, für die anerkannt sei, dass es für die Prüfung der Verwertbarkeit auf den Zeitpunkt der Anordnung der Eingriffsmaßnahme oder der Verwendung in einem anderen Strafverfahren ankommt (vgl. – nicht tragend – Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Beschluss vom 13. Mai 2024 -1 Ws 32/24 – Rn. 72) überzeugt dies nicht. Denn in der Verwendung der aus einem anderen Strafverfahren stammenden personenbezogenen Daten in einem anhängigen Verfahren und in deren Verwertung in einer in diesem Verfahren zu treffenden ‚gerichtlichen Entscheidung liegt ein eigenständiger Grundrechtseingriff. Ob für diesen eine gesetzliche Grundlage besteht, kann und muss daher nach der für den Verwendungs- bzw. Verwertungszeitpunkt geltenden Rechtslage beurteilt werden (BGH, Beschluss vom 21 November 2012— 1 StR 310/12 —, juris, Rn. 45). Nach ständiger Rechtsprechung ist daher bei sich im Verlaufe eines anhängigen Strafverfahrens ändernden strafprozessualen Vorschriften für die Beurteilung der prozessualen Zulässigkeit die neue Rechtslage maßgebend (vgl. BGH, Beschluss. vom 19. Februar 1969 — 4 StR 357/68 -, juris, Rn11; BGH, Urteil vom 27. November 2008 — 3 StR 342/08 juris, Rn. 13; BGH, Beschluss vom 21. November 2012 — 1 StR 310/12, aaO., Rn. 45; BGH, Beschluss vom 02.03.2022 – 5 StR 57/21, aaO., Rn. 70).
Soweit in der Literatur vertreten wird, dass für den Fall, dass nach bisherigem Recht rechtmäßige Maßnahmen für unzulässig erklärt werden, die Frage der Verwertbarkeit der Erkenntnisse – falls keine besondere Überleitungsvorschrift bestehe – jeweils im Einzelfall unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Zwecks der Neuregelung zu beantworten sei (vgl. Kühne/Gössel/Lüderssen in Löwe-Rosenberg StPO, 27. Aufl. 2016, Einleitung E, Rn. 22), führt auch diese Auffassung im vorliegenden Fall nicht zur Verwertbarkeit der von den französischen Ermittlungsbehörden übermittelten Erkenntnisse. Denn eine Prüfung durch den ersuchenden Staat, ob der ersuchte Staat dort vorhandene Beweismittel nach dem Maßstab seiner eigenen nationalen Verfahrensregeln rechtmäßig erlangt hat, ist nicht vorgesehen (vgl. OLG Köln, Beschluss vom 06.06.2024, 2 Ws 251/24; BGH, Beschluss vom 02.03.2022 — 5 StR 457/21, aaO., Rn. 26).
Dürfen demgemäß die hier verfahrensgegenständlichen Chatnachrichten nur zur Verfolgung von auch im Einzelfäll besonders schwerwiegenden Straftaten im Sinne § 100b Abs. 2 StPO verwendet werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos und der Kernbereich privater Lebensführung nicht berührt ist, und ist zudem für die Prüfung, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, auf den Zeitpunkt der Verwertung der Beweisergebnisse im deutschen Strafverfahren abzustellen, unterliegen die hier relevanten Chat-Nachrichten der Kennungen „K 1″ und „K 2″ nach Inkrafttreten KCanG seit dem 01.04.2024 einem Beweisverwertungsverbot.
Ob auch hinsichtlich der dem Angeschuldigten in der Anklageschrift vom 08.03.2024 zur Last gelegten Taten Ziff. 1, 4 und 5 ein Beweisverwertungsverbot anzunehmen ist, kann jedenfalls derzeit dahinstehen. Denn aufgrund des nicht gegebenen Tatortes in Mannheim und in Ermangelung anderer Gerichtsstände ist hinsichtlich dieser Taten eine örtliche Zuständigkeit des Landgerichts Mannheim nicht begründet. Da die örtliche Unzuständigkeit einer sachlichen Entscheidung über das Vorliegen der Eröffnungsvoraussetzungen entgegensteht (vgl. OLG Hamm, Beschluss vom 10.09.1998 – 2 Ws 6/98, NStZ-RR 1999, 16; KK-StPO/Gellhorn, 9. Aufl. 2023, StPO § 16 Rn. 8; 3 Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 66. Auflage, § 16 Rn. 4 m.w.N.), war es dem Landgericht verwehrt, die Eröffnung des Hauptverfahrens hinsichtlich dieser Taten abzulehnen. Daher war auf die sofortige Beschwerde der Staatsanwaltschaft Ziff. 3 des angegriffenen Beschlusses aufzuheben, soweit dort die Eröffnung des Hauptverfahrens hinsichtlich der dem Angeschuldigten in der Anklageschrift vom 08.03.2024 zur Last gelegten Taten Ziff. 1, 4 und 5 abgelehnt wurde, und insoweit die örtliche Unzuständigkeit des Landgerichts Mannheim festzustellen.“