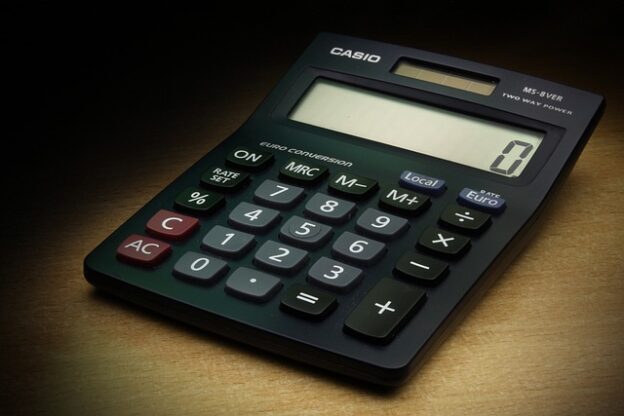Bild von Christian Dorn auf Pixabay
Heute dann Gebührentag. Und an dem stelle ich mal wieder drei Entscheidungen zur Pauschgebühr (§ 51 RVG) vor. Ja, die gibt es noch. Obwohl: Das, was als Pauschgebühr von den OLG „gewährt“ wird, sind meist lächerliche Beträge.
Ich beginne mit dem KG, Beschl. v. 28.11.2023 – 1 AR 17/22 – zur Pauschgebühr für den Nebenklägerbeistand. Ergangen ist der Beschluss nach einem Schwurgerichtsverfahren. Das war vor einer Schwurgerichtskammer des LG Berlin mit dem Vorwurf des Mordes ursprünglich gegen elf Angeklagte, nach einer Verfahrensabtrennung am 6. Juli 2017 gegen zehn Angeklagte und in einem Trennverfahren gegen den elften Angeklagten., anhängig. Die erstinstanzlichen Verfahren wurden durch die Urteile vom 01.10.2019 (Ursprungsverfahren) und vom 18.12.2019 (Trennverfahren) beendet. Der Antragsteller meldete sich am 27.10.2014 für die Schwester des Tatopfers, die als Nebenklägerin zugelassen und der der Antragsteller am 27. 10.2014 als Vertreter bestellt wurde. In dieser Funktion war er sowohl im Ursprungs- als auch im Trennverfahren tätig.
An gesetzlichen Gebühren hatte der Beistand bisher insgesamt 197.424 EUR für die Grundgebühr, die Verfahrensgebühr (erster Rechtszug) und die Terminsgebühren (erster Rechtszug) erhalten. Er hat dann einen auf § 51 RVG gestützten Antrag auf Festsetzung einer Pauschvergütung von jeweils 20.000 EUR anstelle der gesetzlichen Grund- und Verfahrensgebühren (erster Rechtszug) und von 304.152 EUR anstelle der Terminsgebühren (erster Rechtszug), insgesamt auf 344.152 EUR gestellt. Das KG hat unter Zurückweisung des Antrags im Übrigen anstelle der Verfahrensgebühr nach Nr. 4118 VV RVG und der Terminsgebühren nach Nr. 4120 und 4122 VV RVG eine Pauschgebühr in Höhe von 211.056 EUR bewilligt.
Das KG referiert zunächst die Voraussetzungen des § 51 RVG. Da werden dann die Begriffe: „Ausnahmecharakter“ und vor allem auch wieder „exorbitant“ wiederholt. Die Passage kann man sich sparen. Das kennen wird.
Zur konkreten Sache heißt es dann:
„2. Die Inanspruchnahme des im gerichtlichen Hauptverfahren erstmals mit der Sache befassten Antragstellers ist mit den für das Verfahren des ersten Rechtszuges und die für die Wahrnehmung der Hauptverhandlungstermine in dem Zeitraum vom 8. November 2017 (dem Beginn der Hauptverhandlung in dem Trennverfahren) bis zum 1. Oktober 2019 (der Urteilsverkündung im Ursprungsverfahren) gesetzlich vorgesehenen Gebühren, nicht hingegen mit der für die erstmalige Einarbeitung in die Sache gesetzlich vorgesehenen Gebühren, unzumutbar im Sinne der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung (vgl. BVerfGE 68, 237) vergütet.
a) Einen hervorgehobenen Umfang oder besondere Schwierigkeiten rechtlicher oder tatsächlicher Art hat die Sache bei der erstmaligen Einarbeitung nicht aufgeworfen. Diese – bei der Übernahme des Mandates. Ende Oktober 2014 erfolgte – erstmalige Einarbeitung ist mit der Grundgebühr (Nr. 4100 VV RVG) abgegolten.
Die Antragsbegründung und der Akteninhalt rechtfertigen eine abweichende Auffassung nicht Bei der erstmaligen Einarbeitung in die Sache, dem Erstgespräch mit der Mandantin und der damit einhergehenden Sachverhaltsermittlung wurde der Antrag-steller, was sowohl er als auch der Bezirksrevisor in ihren Ausführungen vernachlässigen, mit einem tatsächlich und rechtlich einfach gelagerten Sachverhalt konfrontiert Mehrere Täter – so der Tatvorwurf – töteten den Bruder der späteren Nebenklägerin. Darüber hinausgehende konkrete Umstände (jenseits der in der Stellungnahme des Bezirksrevisors vom 9. August 2023 abstrakt dargelegten denkbaren anwaltlichen Tätigkeiten) geben für dieses Verfahrensstadium weder die Antragsschrift noch deren ergänzende Begründungen wieder. Mit ihnen sind keine Tatsachen dargelegt worden, die eine außergewöhnliche anwaltliche Mühewaltung offenbaren. Stattdessen hat der Antragsteller in seinem Schriftsatz vom 8. November 2023 vorgetragen, sich vor seiner Bestellung zum Nebenklägervertreter erstmals in die Strafsache eingearbeitet zu haben; konkrete anwaltliche Tätigkeiten, die in den Bereich der erstmaligen Einarbeitung in eire Sache und damit der Grundgebühr fallen, hat er nicht benannt, sondern sich trotz der ihm mit Schreiben vom 7. November 2023 eröffneten Gelegenheit zur Konkretisierung auch weiterhin auf Bewertungen der eigenen Tätigkeit als außergewöhnlich schwierig und umfangreich beschränkt. In den Akten findet sich lediglich der Meldeschriftsatz und ein einseitiger Antrag auf Schwärzung der Wohnanschrift der an diesem Tag als Nebenklägerin zugelassenen Schwester des Tatopfers. Die danach, erstmals mit der Ladungsverfügung vom 27. Oktober 2014 eröffnete und dem Antragsteller nach seinen Angaben erst „knapp vor dem Beginn der Hauptverhandlung gewährte „Akteneinsicht fällt in das gerichtliche Hauptverfahren und ist dort – wegen des Umfanges der Akten und der Erschließung ihres Inhalts parallel zu der bereits begonnenen Hauptverhandlung – mit der 12fachen Erhöhung der gesetzlich vorgesehenen Gebühr berücksichtigt worden. Eine doppelte Berücksichtigung, wie sie offenbar der Bezirksrevisor vornehmen will, spiegelt die konkrete anwaltliche Mühewaltung nicht wider. Es kommt- auch wegen der Berücksichtigung der Sichtung des Aktenbestandes im Hauptverfahren – dabei nicht darauf an, ob der Antragsteller bereits zuvor (erfolglos) um Akteneinsicht ersucht hatte und wegen eines durch die Kammer angenommenen „Vorrang(es)“ der Verteidiger auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet worden war.
b) Die anwaltliche Mühewaltung im gerichtlichen Verfahren (erster Rechtszug) rechtfertigt die Erhöhung der gesetzlichen Gebühr nach Nr. 4118 VV RVG um das Zwölffache, auf einen – die gesetzliche Gebühr ersetzenden – Betrag von 3.792 Euro.
Die im Einklang mit den Ausführungen des Bezirksrevisors angenommene Erhöhung beruht auf der Dauer des gerichtlichen Verfahrens im ersten Rechtszug und dem Aktenumfang, der vor allem zum Ende der Hauptverhandlungen in beiden Verfahren – vornehmlich bedingt durch die den Interessen der Nebenklägerin widerstreitenden Anträge der Verteidiger – angewachsen ist, wie der Antragsteller und der Bezirksrevisor zutreffend herausgearbeitet haben. Beide übersehen zu Gunsten des Antragstellers zwar, dass sich die erste Akteneinsicht auf Hauptakten beschränkte, die z.B. in den Bänden 3 bis 7 und 13 fast ausschließlich oder zu einem überwiegenden Teil Unterlagen enthalten, die die Vertretungs- und Haftverhältnisse der Angeklagten betreffen oder Doppel von Vernehmungsniederschriften sind, daher der intensiven Befassung durch den Antragsteller nicht bedurften. Bezüglich des in der Folge gesichteten Aktenbestandes ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass er wegen der Vielzahl von anwaltlichen Verfahrensbeteiligten in weiten Teilen aus Akteneinsichtsschriftsäten sowie Anträgen, Beschlüssen und Mitteilungen betreffend die Haftverhältnisse der Angeklagten bestand, die doppelt und dreifach eingereicht bzw. ausgedruckt oder als Faxabschriften zu den Akten gelangt sind. Diese betrafen die Vertretung durch den Antragsteller nicht direkt, erforderten, jedenfalls keinen erheblichen Arbeitsaufwand. Dies gilt auch für die Beiakten, die ohnehin weit überwiegend Vorstrafen der Angeklagten betreffen, oder bei denen es sich um Gefangenenpersonalakten (pp. u.a.) handelte. Auch die zuletzt in der Regel per E-Mail des Kammervorsitzenden übermittelten Nachlieferungen bestehen zu einem erheblichen Teil um schnell zu erfassende (Ergänzungen von) Aussagegenehmigungen, Verhinderungsanzeigen von Zeugen und Lichtbildkonvolute. Diesem, den Umfang des Arbeitsanfalls deutlich relativierenden Umstand, steht allerdings die reine Menge des durch den Nebenklägervertreter – im Gegensatz zu den Verteidigern ohne die Möglichkeit zur Arbeitsteilung – vor allem zu Beginn der Hauptverhandlung im Ursprungsverfahren zudem in kurzer Zeit zu bewältigenden Materials gegenüber, wenngleich die Übersendung von dem Antragsteller aus dem Trennverfahren bekannten Unterlagen (vgl. z.B. Bd. 48 BI. 143) nicht doppelt berücksichtigt werden dürfen.
Umfang und Schwierigkeit der Strafsache werden zudem durch einen Blick auf den Tatvorwurf deutlich relativiert. Verglichen mit den in der Regel komplexen und wegen des vom Gesetzgeber unterstellten erhöhten Arbeitsanfalls ohnehin höher vergüteten erstinstanzlichen Staatsschutzsachen mit OLG-Zuständigkeit sowie Strafsachen, die vor den Schwurgerichts- oder Wirtschaftsstrafkammern des Landgerichts gewöhnlich verhandelt werden, warf die Strafsache keinen hervorgehobenen Umfang oder besondere Schwierigkeiten rechtlicher oder tatsächlicher Art auf.. Im Gegenteil: Es handelte sich (auch weiterhin) um einen mehr als überschaubaren und einfach gelagerten Tatvorwurf, der sich im Verlaufe des Verfahrens nicht änderte und lediglich das Problem der Identifizierung der vielen Täter aufwarf. Verfahrensgegenstand war durchweg der folgende Vorgang: 12 Täter, darunter zehn Angeklagte, begaben sich auf die Weisung eines Mitangeklagten in ein Lokal; einer von ihnen erschoss entsprechend dem vorab gefassten Tatplan das Opfer. Der auf einem Video festgehaltene Tathergang dauerte lediglich 25 Sekunden.
Diesen konkreten, die anwaltliche Beanspruchung mindernden Umstände steht die anwaltliche Betätigung des Nebenklägervertreters gegenüber. Den Akten ist insoweit zu entnehmen, dass sich. der Antragsteller mehrfach in das Hauptverfahren eingebracht hat; beispielhaft sind insoweit Anträge auf Abtrennung des Verfahrens gegen den Angeklagten pp. (Bd. 23 Bl. 59), Stellungnahmen zu dem Akteneinsichtsantrag eines Zeugenbeistands (Bd. 24 BI. 53) und dem Haftantrag eines Verteidigers (Bd. 30 BI. 125) sowie die Weiterleitung ihm von einem anderen Nebenklägervertreter zugesandter Bilddateien an die Kammer (Bd. 35 Bl. 108) zu nennen. Dies, die Verfahrensdauer und der – mit den oben genannten Einschränkungen zu betrachtende – Aktenumfang, haben zur Folge, dass auch der Senat die zwölffache Erhöhung der Verfahrensgebühr für angemessen erachtet.
Eine weitergehende Erhöhung tragen weder die Antragsbegründung noch der Akteninhalt Die vom Antragsteller bemühten wirtschaftlichen Erwägungen vermögen aus den vom Bezirksrevisor zutreffend genannten Gründen – unabhängig von der Frage des kausalen Zusammenhanges zwischen Gewinnrückgängen und der Vertretung in einer Strafsache — die Gewährung einer Pauschvergütung, die ausschließlich von der konkreten und außergewöhnlich großen Mühewaltung getragen werden kann, nicht zu begründen. Soweit der Antragsteller vorgetragen hat, er habe die Nebenklägerin mindestens einmal im Monat aufgesucht und „jeweils nach dem Termin oder auch nur 2 x die Woche ausführliche Telefonate (…) zur Unterrichtung über den Sachstand“ geführt, auch um „strafprozessuale Fragen für einen juristischen Laien in einfache Sprache umzusetzen und zu erläutern“, umschreibt dies keine den gewöhnlichen Arbeitsaufwand erheblich übersteigende Beanspruchung, sondern die gewöhnlichen Pflichten eines Rechtsanwaltes, dessen Bestellung gerade dazu dient, einer Nichtjuristin wie der Nebenklägerin juristische Vorgänge zu verdeutlichen. Die vermeintlichen außergewöhnlichen Erschwernisse durch das „mediale Interesse“ hat der Antragsteller trotz des entsprechenden Hinweises des Bezirksrevisors (auch weiterhin) nicht konkret dargelegt Eine in seinem Schriftsatz vom 28. August 2023 beispielhaft erwähnte Veröffentlichung fällt nicht in die Zeit des gerichtlichen Verfahrens erster Instanz („während des Revisionsverfahrens“); im Übrigen bleiben die Angaben vage, denn aus der Erwähnung „mehrerer Reportagen“ oder „zahlreicher Anfragen“ gehen weder deren Anzahl, Dauer oder Zeitpunkt hervor noch erschließt sich die konkrete Beanspruchung des Antragstellers.
c) Eine besondere Bindung der Arbeitskraft des Antragstellers nimmt der Senat – aus den in der Stellungnahme des Bezirksrevisors auch insoweit zutreffend aufgeführten Erwägungen – für den Zeitraum der parallel im Ursprungs- und im Trennverfahren geführten Hauptverhandlungen, an denen der Antragsteller an knapp drei Verhandlungstagen je Woche teilnahm, mit einer Pauschale für die letzten beiden Jahre vor der Urteilsverkündung am 1. Oktober 2019.. in Höhe von jeweils 5.000 Euro an.
Eine höhere Pauschvergütung ist nicht gerechtfertigt. Zum einen ist der Antragsteller durch die große Anzahl der jeweils einzeln vergüteten 400 Verhandlungstage besser gestellt worden als in einem durchschnittlichen Verfahren (ständige Rechtsprechung des Senats, vgl. statt vieler Beschlüsse vom 4. November 2021- 1 ARs 35720 – und vom 23. Juli 2019 – 1 ARs 12/17 -). Zum anderen ist auch die Teilnahme an den Hauptverhandlungsterminen, die – ohne die 19.504 Euro, die die Terminsvertreter an den Antragsteller abgetreten haben – mit 196.948 Euro vergütet worden sind, durch den einfach gelagerten Tatvorwurf und den Umstand geprägt gewesen, dass allein die Vielzahl an anwaltlichen Verfahrensbeteiligten, die Feststellung deren An- und Abwesenheiten und (bloße) Anschlusserklärungen einen weiten Raum in den Terminen einnahmen, was das Sitzungsprotokoll des Ursprungsverfahrens eindrucksvoll belegt. Es ist daher hier nicht sonderlich maßgebend, dass die Anzahl der vom Antragsteller hervorgehobenen Beweiserhebungen ohnehin kein Bemessungskriterium i:S.d. § 51 RVG ist. Soweit eine Vielzahl von Beweiserhebungen lange Sitzungstage nach sich zieht, wird dies mit Längenzuschlägen honoriert, hier mit gewichtigen 129 Zuschlägen nach Nr. 4122 VV RVG in Höhe von insgesamt 27.348 Euro. Im Einklang mit den Ausführungen des Bezirksrevisors war überdies zu berücksichtigten, dass der vom Gesetzgeber angenommenen überdurchschnittlichen Schwierigkeit und Arbeitsbelastung in Schwurgerichtssachen gegenüber erstinstanzlichen Strafsachen vor dem Amtsgericht oder einer anderen Großen Strafkammer nicht nur durch höhere Verfahrensgebühren, sondern auch durch erhöhte Terminsgebühren Rechnung getragen wird. Diese gelten auch die für diese Verfahren antizipierten besonders intensiven und wegen der Verfahrensdauer gewöhnlich auch deutlich aufwändigeren Vor- und Nachbereitungen der Hauptverhandlungstermine ab, die abgesehen hiervon.- ebenso wie die Fertigung von Mitschriften während der Hauptverhandlung – ohnehin zu den selbstverständlichen und daher nicht besonders zu vergütenden anwaltlichen Pflichten gehören. Es kommt hinzu, dass die Wahrnehmung der Hauptverhandlungstermine bis zur beginnenden Verhandlung im Trennverfahren den Antragsteller an lediglich 1,2 Verhandlungstagen pro Woche [außerhalb der Feiertage und der Urlaubszeiten] mit einer durchschnittlichen und damit für Schwurgerichtssachen (sechs Stunden, vgl. Senat, Beschluss vom 4. November 2021 – 1 ARs 35/20 -) unterdurchschnittlichen Länge von viereinhalb Stunden in Anspruch nahmen.“
Nun? Ja, richtig. Viel Lärm um nichts ode rum „nicht viel“. Und: Es spricht, sehr viel dafür, auch wenn man die genauen Einzelumstände des Verfahrens nicht kennt, dass das KG nicht richtig liegt, und zwar:
1. Das KG geht schon vom falschen Vergleichsmaßstab aus, wenn es u.a. darauf abstellt, dass sich für die Gewährung einer Pauschgebühr nach § 51 RVG die anwaltliche Mühewaltung „von sonstigen – auch überdurchschnittlichen Sachen – in exorbitanter Weise abheben“ müsse. Durch das Abstellen auf ein „exorbitantes Abweichen“ wird nämlich der Vergleichsmaßstab so verschoben, dass die Gewährung von Pauschgebühren praktisch ausgeschlossen ist. Das war aber nicht das Anliegen des Gesetzgebers bei Schaffung des § 51 RVG. Denn auch, wenn die (neue) Anspruchsvoraussetzung „Unzumutbarkeit“ eingeführt worden ist, sollte es noch Pauschgebühren geben. Der BGH und die OLG scheinen es aber besser zu wissen.
2. Falsch sind auch die Ausführungen des KG zur Zulässigkeit der Kompensation. Diese ist – entgegen der Auffassung des KG, die allerdings zum Teil auch von anderen OLG vertreten wird – unzulässig. Das gilt vor allem, wenn – wie hier – eine auf Verfahrensabschnitte beschränkte Pauschgebühr geltend gemacht wird. Denn durch einen solchen „beschränkten“ Antrag macht der bestellte/beigeordnete Rechtsanwalt gerade deutlich, dass er mit den gesetzlichen Gebühren für die die Verfahrensabschnitte, für die eine Pauschgebühr nicht geltend gemacht wird, angemessen honoriert ist. Dann kann man aber nicht diese Gebühren heranziehen, um ggf. eine Pauschgebühr für einen anderen Verfahrensabschnitt abzulehnen. Denn diese Gebühren stehen gar nicht zur Überprüfung an.
Mit diesem Einwand korrespondieren meine Bedenken gegen die Überlegung des KG, dass „der Antragsteller durch die große Anzahl der jeweils einzeln vergüteten 400 Verhandlungstage besser gestellt worden [ist] als in einem durchschnittlichen Verfahren“. Ja, aber es darf doch nicht übersehen werden, dass er für die dafür gewährten gesetzlichen Gebühren an 400 Hauptverhandlungstermine teilgenommen hat. Man kann dann doch diese für erbrachten Zeitaufwand erzielte „Einnahme“ nicht heranziehen, um eine höhere Pauschgebühr abzulehnen. Das ist m.E. widersprüchlich und entwertet die Entlohnung für die Teilnahme an den Hauptverhandlungsterminen.