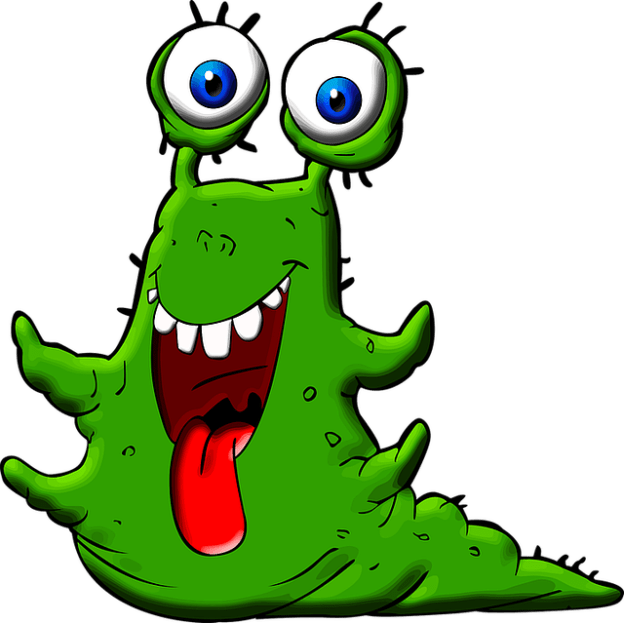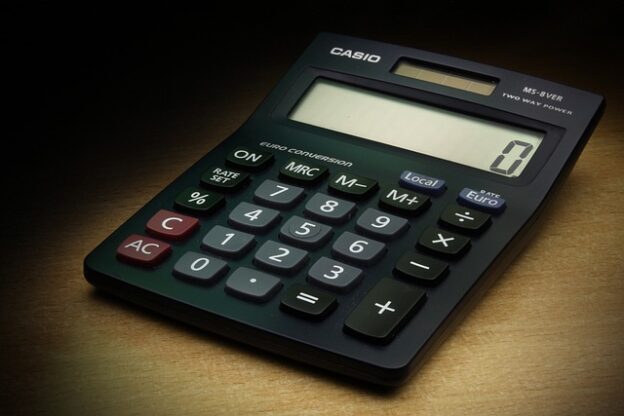Im „Kessel Buntes“ wird es dann heute wirklich bunt.
Zunächst kommt hier eine Entscheidung des AGH Hamm, und zwar der AGH Hamm, Beschl. v. 23.08.2024 – 2 AGH 12/18. Gestritten worden ist in dem Verfahren um ein Zwangsgeld, das gegen eine Rechtsanwältin festgesetzt worden ist, die mit der Ausstellung des Zeugnisses für eine ihr zur Ausbildung zugewiesene Referendarin erheblich in Verzug war. Das Zwangsgeld ist zwar inzwischen aufgehoben worden, der AGH sagt bei der Begründung der Kostenentscheidung zu Lasten der Rechtsanwältin aber etwas zur Berechtigung der Festsetzung:
„Das Verfahren ist in der Hauptsache erledigt, nachdem der Vorstand der Antragstellerin in seiner Sitzung vom 07.06.2018 die Aufhebung des Zwangsgeldes beschlossen hat. Aufgrund der Aufhebung der Zwangsgeldfestsetzung hat sich das Antragsverfahren erledigt (vgl. Böhnlein in Feuerich/Weyland, BRAO, 8.Aufl., § 58 Rn. 16).
III.
Der Antragsstellerin sind gem. §§ 197, 197 a BRAO die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Über die angefallenen Kosten ist im Fall der Erledigung nach den §§ 464 StPO, 197a BRAO nach billigem Ermessen zu entscheiden, wobei grundsätzlich auf den wahrscheinlichen Verfahrensausgang im Falle der Fortführung des Verfahrens abzustellen ist. Die Antragstellerin wäre im weiteren Verfahren voraussichtlich unterlegen gewesen, denn ausweislich der vorgelegten Postzustellungsurkunden ist ihr sowohl die Androhung eines Zwangsgeldes als auch die Festsetzung zugegangen. Irgendwelche Anhaltspunkte dafür, dass die entsprechenden Zustellurkunden der Deutschen Post AG unrichtig seien, hat die Antragstellerin nicht vorgetragen.
Unabhängig davon hat die Antragstellerin die Ursache für das gesamte Verfahren gegeben, indem sie entgegen ihrer Verpflichtung aus § 46 JAG, das Zeugnis unverzüglich nach Abschluss der Ausbildung zu erteilen (vgl. dazu Anwaltsgericht Köln, Beschluss vom 12.10.2011 – 10 EV 160/10), nicht nachkam, sondern erst nach mehrmaliger Aufforderung und mehrmonatiger Verzögerung ihrer Verpflichtung nachkam.
Daher entspricht es dem billigen Ermessen, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.W