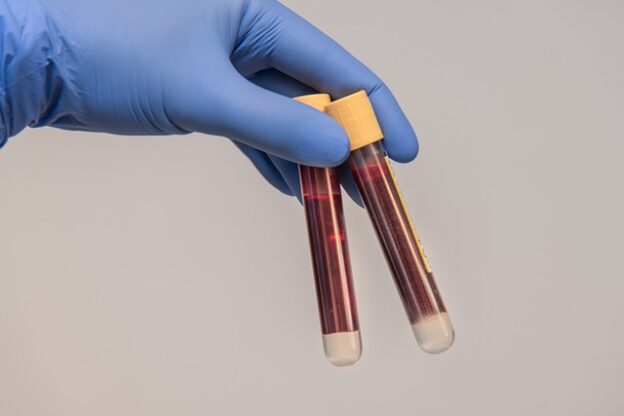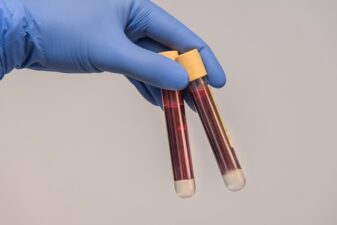Bild von Sabine auf Pixabay
Und dann ein OWi-Tag.
Den eröffne ich mit zwei Entscheidungen des OLG Hamm zum FahrpersonalG, und zwar zu Verstöße eines Unternehmers gegen das FahrpersonalG. In beiden Entscheidungen geht es darum, dass dem betroffenen Unternehmer Verstöße gegen § 8a Abs. 1 Nr. 2 FPersG zur Last gelegt worden waren. Diese Vorschrift verlangt vom Unternehmer, dass er dafür sorgt, dass die vorgeschriebenen Lenkzeiten und Fahrtunterbrechung oder die erforderlichen Ruhezeiten vom Fahrer eingehalten werden.
Zur konkreten Vorstellung nehme ich dann mal den OLG Hamm, Beschl. v. 19.03.2024 – III-4 ORbs 31/24. Das OLG das amtsgerichtliche Urteil, mit dem der Betroffene zu einer Geldbuße von 25.000 EUR verurteilt worden ist, wegen nicht ausreichender Feststellungen aufgehoben. Begründung, in der das OLG zunächst die Stellungnahme der GsTA „eingerückt“ hat:
„Die gemäß § 79 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 OWiG statthafte Rechtsbeschwerde ist rechtzeitig eingelegt sowie form- und fristgerecht begründet worden und hat auch in der Sache – jedenfalls vorläufig – Erfolg.
Das Urteil unterliegt bereits auf die Sachrüge der Aufhebung, da es keine ausreichenden Feststellungen zu den Tatvorwürfen enthält.
a) Die Vorschrift des § 8a Abs. 1 Nr. 2 FPersG, auf welche das Amtsgericht die Verurteilung u. a. gestützt hat, nimmt Bezug auf die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006. Gemäß Art. 2 Abs. 1 a) der vorgenannten Verordnung gilt diese nur für Güterbeförderungen im Straßenverkehr, deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger oder Sattelanhänger 3,5 t übersteigt.
Gemäß ihres Art. 2 Abs. 2 gilt sie in räumlicher Hinsicht zudem ausschließlich für Beförderungen im Straßenverkehr innerhalb der Gemeinschaft oder zwischen der Gemeinschaft, der Schweiz und den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist in dem angefochtenen Urteil indes nicht festgestellt. Insbesondere enthält die mit dem Urteil verbundene Verstoßliste keine entsprechenden Fahrzeug- bzw. Streckeninformationen. Es ist daher unklar, ob der Anwendungsbereich der angewandten Bußgeldnorm überhaupt eröffnet ist.
Gleiches gilt, soweit Verstöße – jedenfalls ausweislich der diesbezüglichen Liste – zum Teil auf § 8 Abs. 1 Nr. 1 b) FPersG.i. V. m. Art. 32 Abs. 1 der VO (EU) Nr. 165/2014 gestützt werden, da diese Verordnung gemäß ihres Art. 3 Abs. 1 nur für Fahrzeug gilt, die dem Anwendungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 unterfallen, was vorliegend nicht ausreichend festgestellt ist.
b) Auch die Überprüfung des Rechtsfolgenausspruchs führt zur Aufdeckung von Rechtsfehlern zum Nachteil des Betroffenen. Insbesondere ist zu bemängeln, dass das Amtsgericht keinerlei Feststellungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen getroffen hat (§ 17 Abs. 3 S. 2 OWiG). Die Feststellung, es lägen keine Anhaltspunkte dafür vor, die verhängte Geldbuße könne den Betroffenen in finanzielle Nöte stürzen, zumal dessen Verteidiger auf entsprechende Nachfrage keine Angaben gemacht habe, reichen insoweit nicht aus. Weitergehende Feststellungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen sind nur bei geringfügigen Geldbußen entbehrlich. Hiervon kann bei einer Summe von 25.000,- € indes nicht die Rede sein.
2. Auf die von dem Betroffenen erhobenen Verfahrensrügen kommt es nicht mehr an.
Die Sache bedarf insgesamt erneuter Verhandlung und Entscheidung.“
Diesen zutreffenden Ausführungen der Generalstaatsanwaltschaft schließt sich der Senat nach eigener Sachprüfung an und macht sie zum Gegenstand seiner Entscheidung.“
Und dann gibt es aber noch reichlich Eigenes 🙂 :
„Für das weitere Verfahren weist der Senat auf Folgendes hin:
1. Ordnungswidrig sind nur Verstöße, die von einem Unternehmer (§ 8 Abs. 1 und § 8a Abs. 1 FPersG) begangen worden. sind. Bei der hier vorliegenden Internationalen Speditions-GmbH & Co. KG erfüllt der Betroffene nur dann das besondere persönliche Merkmal eines „Unternehmers“, wenn und soweit er als vertretungsberechtigtes Organ (Geschäftsführer) der Komplementär-GmbH (§ 9 Abs. 1 Ziff. 1 OWiG) gehandelt hat bzw. wenn und soweit er – ohne selbst Geschäftsführer zu sein – von dem Geschäftsführer der Komplementär-GmbH oder einem sonst dazu Befugten beauftragt ist, den Betrieb ganz oder zum Teil zu leiten oder ausdrücklich beauftragt ist, in eigener Verantwortung Aufgaben wahrzunehmen, die dem Inhaber des Betriebs obliegen und aufgrund dieses Auftrags gehandelt hat (§ 9 Abs. 2 Ziff. 1 bzw. Ziff. 2 OWiG) (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12. Dezember 2006 – IV-2 Ss (OWi) 124/06 – (OWi) 67/06 III – juris Rn. 6).
Im Übrigen kann zur Bestimmung des Unternehmerbegriffs ergänzend auch auf die entsprechende Regelung in § 3 PBefG Bezug genommen werden. Danach gilt als Unternehmer, wer den Verkehr im eigenen Namen unter eigener Verantwortung und für eigene Rechnung betreibt. Im eigenen Namen betreibt ein Unternehmen, wer nach außen hin als Inhaber des Unternehmens auftritt. Unter eigener Verantwortung bedeutet, dass der Handelnde der Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde gegenüber die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung des Betriebs trägt. Für eigene Rechnung handelt derjenige, dem Lasten und Nutzen des Betriebes, wenn auch nicht ganz, so doch mindestens zu einem erheblichen Teil zufallen. Folglich gilt als Unternehmer, wer u.a. die Fahrzeuge einsetzt, Verträge abschließt, Arbeitskräfte bestellt, Fahrzeuge zur Reparatur gibt, Art und Inhalt der Buchführung bestimmt und jederzeit die Kontrollmöglichkeit hat. Für diese rechtliche Beurteilung der Unternehmereigenschaft ist dabei vor allem die Eintragung im Handelsregister, die Gewerbeanmeldung sowie die Erteilung der CEMT-Genehmigung für den Verkehr zwischen Staaten der EU und anderen Staaten ein wichtiges Indiz und bedarf entsprechender konkreter Feststellungen durch das Tatgericht (OLG Bamberg, Beschluss vom 4. Dezember 2007 – 2 Ss OWi 1265/07 -juris Rn. 23).
Die bloße tatsächliche Wahrnehmung der dem Inhaber des Betriebes aus dem Fahrpersonalgesetz erwachsenen Pflichten durch den Betroffenen würde für eine Verantwortlichkeit im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 2 OWiG nicht ausreichen. Erforderlich wäre vielmehr ein Auftrag, der ausdrücklich und unter Hinweis auf die Verantwortlichkeit für die Pflichten, die dem Betriebsinhaber bei der Überwachung des Fahrpersonals obliegen, erteilt worden wäre. Dabei hätte der Betroffene damit beauftragt werden müssen, diese Pflichten in eigener Verantwortung zu erfüllen, d.h. mit entsprechenden Selbständigkeit und Entscheidungsfreiheit (vgl. OLG Hamm a.a.O., OLG Schleswig VRS 58, 384, 386). Der Betroffene hätte in der Lage sein müssen, von sich aus ohne Weisung des Betriebsinhabers die Maßnahmen zu ergreifen, die zur Erfüllung der Pflichten aus dem Fahrpersonalgesetz notwendig waren (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12. Dezember 2006, a.a.O., Rn. 7, juris).
Entsprechende Feststellungen lässt die angefochtene Entscheidung vermissen. Dort ist ausgeführt, der Betroffene sei bis zum 15. Juli 2019 Geschäftsführer (gemeint ist wohl Geschäftsführer der Komplementär-GmbH) gewesen und ab dem 16. Juli 2019 habe pp. die Geschäftsführung und zugleich die Aufgabe des Verkehrsleiters übernommen, es sei jedoch originäre Aufgabe des Betroffenen als bis dahin Verantwortlicher und Geschäftsführer, dafür Sorge zu tragen, dass ein neuer Geschäftsführer und Verkehrsleiter seinen Aufgaben unter Einhaltung der Rechtsvorschriften nachkomme. Aus diesen Erwägungen allein kann eine Verantwortlichkeit des Betroffenen für die Zeit ab dem 15. Juli 2019 jedoch nicht begründet werden. Eine solche würde nur dann bestehen, wenn – was im Einzelnen festzustellen wäre – der Betroffene von dem Geschäftsführer gemäß den vorstehenden Ausführungen konkret mit der Überwachung des Fahrpersonals in eigener Verantwortung beauftragt worden wäre, was ggf. auch durch die Vernehmung einzelner Mitarbeiter aufgeklärt werden kann. Zudem werden die einschlägigen Handelsregisterauszüge (auch betreffend die Komplementär-GmbH) beizuziehen und durch Verlesung in die Hauptverhandlung einzubeziehen sein.
2. Die bußgeldbewehrte Pflichtwidrigkeit besteht darin, dass der Unternehmer nicht dafür sorgt, dass die Sozialvorschriften eingehalten werden, also in einem Unterlassen. Das Amtsgericht muss folglich Feststellungen dazu treffen, welche Verpflichtungen den Betroffenen treffen, ob und inwieweit der Betroffene gegen diese Verpflichtungen verstoßen hat und ‚ob die Pflichtverletzung kausal zu Verstößen gegen Sozialvorschriften geführt hat. Solche Feststellungen fehlen bislang gänzlich und müssten zunächst noch getroffen werden.
Dabei wird das Amtsgericht davon auszugehen haben, dass der Unternehmer verpflichtet ist, das Fahrpersonal in regelmäßigen zeitlichen Abständen auf die maßgeblichen Lenk- und Ruhezeiten hinzuweisen, wöchentlich die Schaublätter der EG-Kontrollgeräte zu überprüfen und im Übrigen die Fahrten so zu disponieren, dass den Fahrern unter Berücksichtigung des Bestimmungsortes, der Streckenführung und der Zeiten für An- und Abfahrt sowie für Be- und Entladung die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten möglich ist. Bei Vernachlässigung dieser Pflichten wird ferner zu prüfen sein, ob festgestellten Verstöße gegen Sozialvorschriften ursächlich auf die fehlende oder unzulängliche Belehrung und Überwachung zurückzuführen sind (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 12. Dezember 2006 – IV-2 Ss (OWi) 124/06 – (0Wi) 67/06 III – juris Rn. 14; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 21. Dezember 2007 – IV-2 Ss (OWi) 83/07 – (OWi) 64/07 III – juris Rn. 18 ff.; OLG Koblenz, Beschluss vom 23. April 2001 – 1 Ss 29/01 – juris Rn. 20 f.; vgl. zu den Verpflichtungen Häberle in Erbs/Kohlhaas, Strafrechtliche Nebengesetze, Werkstand 249. EL September 2023, Verordnung (EU) 561/2006 Art. 10 Rn. 4 ff.).
Entsprechende Feststellungen im Hinblick auf den Pflichtenkreis des Unternehmers werden sich wohl erst nach Auswertung von Geschäftsunterlagen bzw. der diesbezüglichen Vernehmung des Zeugen H. und erforderlichenfalls auch der zeugenschaftlichen Vernehmung von einzelnen Fahrern treffen lassen.
Soweit es um die Frage geht, ob Verstöße des Unternehmers gegen die ihm obliegenden Pflichten sich kausal durch Verstöße gegen Sozialvorschriften ausgewirkt haben, kommt es nicht darauf an, ob die einzelnen Verstöße den Fahrern jeweils subjektiv vorwerfbar sind. Denn Sanktionsgrund gegenüber dem Unternehmer ist die Verletzung seiner einheitlichen umfassenden Aufsichts- und Überwachungspflicht, während der Fahrer – worauf es hier nicht ankommt – mit jedem einzelnen Verstoß gegen die Bestimmungen der EU-Verordnungen ordnungswidrig handelt (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 15. Juli 2010 – 2 Ss-OWi 276/10 – juris Rn. 19). Daher ist es in diesem Zusammenhang ausreichend, wenn das Vorliegen von – kausal verursachten – Verstößen gegen Sozialvorschriften objektiv festgestellt werden kann. Nicht auch wird es einer zeugenschaftlichen Vernehmung von Fahrern zu der Frage bedürfen, inwieweit der Verstoß jeweils dem Fahrer individuell vorwerfbar ist.
3. Die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 gilt nur für Beförderungen im Straßenverkehr ausschließlich innerhalb der Europäischen Gemeinschaft oder zwischen der Gemeinschaft, der Schweiz und den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (Art. 2 Abs. 2 der Verordnung).
Aus den Feststellungen des Urteils muss sich daher ergeben, dass es sich bei den Fahrten, bei denen es infolge des Pflichtverstoßes des Betroffenen zu Verstößen gegen die zulässige Lenk- bzw. Ruhezeit gekommen. ist, um Beförderungen innerhalb des vorgenannten räumlichen Gebiets gehandelt hat (vgl. OLG Koblenz, Beschluss vom 23. April 2001 – 1 Ss 29/01 -juris Rn. 17; OLG Bamberg, Beschluss vom 30. Januar 2014 – 3 Ss OWi 284/13 juris Rn. 5).
4. Die Feststellungen in der angefochtenen Entscheidung vermögen eine vorsätzliche Pflichtverletzung nicht. zu tragen. Ein vorsätzlicher Verstoß kann nur dann bejaht werden, wenn der Betroffene positiv gewusst hat, dass er seinen Organisations-, Anweisungs- bzw. Überprüfungspflichten nicht gerecht wird oder dies jedenfalls billigend in Kauf genommen hat.
Es ist aber zulässig, aus dem Vorhandensein einer Vielzahl festgestellter Verstöße . Rückschlüsse auf das subjektive Element zu ziehen.
5. Der Vorwurf, nicht für die Einhaltung der Lenkzeiten, Fahrtunterbrechungen oder Ruhezeiten von (mehreren) Fahrern oder die richtige Verwendung von EG-Kontrollgeräten Sorge getragen zu haben, knüpft an ein (echtes) Unterlassen an, weshalb regelmäßig von nur einem einheitlichen Verstoß auszugehen und nur eine einzige Geldbuße festzusetzen ist (OLG Bamberg, Beschluss vom 30. Januar 2014 – 3 Ss OWi 284/13 – juris; OLG Koblenz, Beschluss vom 23. April 2001 – 1 Ss 29/01 – juris; OLG Bamberg, Beschluss vom 30.01.2014 – 3 Ss OWi 284/13 – juris)
6. Die Urteilsgründe müssen stets eine in sich geschlossene, aus sich heraus verständliche Darstellung der Feststellungen und der sie tragenden Beweiserwägungen enthalten (vgl. Schmitt in: Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 66. Auflage 2023, § 267 Rn. 2). Zwar kann bei einer Vielzahl von sich wiederholenden gleichartigen Sachverhalten wegen der Einzelheiten auf eine in dem Urteil enthaltene tabellarische Aufstellung Bezug genommen werden. Jedoch entbinden tabellarische Darstellungen nicht davon, den zugrunde liegenden Sachverhalt, insbesondere das zugrunde liegende tatsächliche Geschehen zunächst einleitend in verständlicher Weise in Worten zu beschreiben.
Entscheidend ist, dass der Verstoß jeweils – differenziert nach Art des Verstoßes (also Lenkzeitverstoß, Ruhezeitverstoß pp.) – in verständlicher Weise beschrieben wird und nur wegen der Gesamtzahl der Verstöße auf Daten Bezug genommen wird, die sich in der in die Darstellung einbezogenen tabellarischen Aufstellung befinden.
Diesen Anforderungen wird die vom Amtsgericht bisher gewählte Art der Darstellung nicht gerecht.
7. Wenn – wie hier – unter nahezu vollständiger Ausschöpfung des Bußgeldrahmens ein Bußgeld in erheblicher Höhe‘ festgesetzt wird, so muss das Urteil in hinreichendem Umfang Feststellungen zu den wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen enthalten.
Einen entsprechenden Hinweis hatte •der Senat dem Amtsgericht in der vorliegenden Sache bereits in seinem Beschluss vom 20. Dezember 2022 erteilt, durch den das vorangegangene Urteil des Amtsgerichts aufgehoben worden war.
Insoweit weist der Senat ergänzend darauf hin, dass die Einkünfte auch durch Schätzung ermittelt werden können. Eine Schätzung ist dann angezeigt, wenn ein Betroffener keine, unzureichende oder gar unzutreffende Angaben macht und eine Ausschöpfung der Beweismittel das Verfahren unangemessen verzögem würde oder der Ermittlungsaufwand zu der konkreten Geldbuße in einem unangemessenen Verhältnis stünde. Als Kriterium einer Schätzgrundlage kommen regelmäßig der – ausgeübte – Beruf eines Betroffenen aber auch sonstige Anzeichen seines sozialen Status in Betracht (OLG Zweibrücken, Beschluss vom 30. September 2021 – 1 OWi 2 SsBs 62/20 – juris Rn. 27; OLG Hamm, Beschluss vom 10. Juli 2019 – 111-3 RBs 82/19 -, juris Rn. 19; Bayerisches Oberstes Landesgericht, Beschluss vom • 11. Februar 2020 – 201 ObOW12771/20 juris Rn. 11). Sollte der Betroffene vorliegend weiterhin keine Angaben zu seinen Einkünften machen, wird das Amtsgericht im Wege einer Schätzung das durchschnittliche Gehalt des Geschäftsführers eines Speditionsunternehmens der Größenordnung des hier in Rede stehenden Unternehmens zugrunde legen dürfen. Bewertungskriterien dürften hierbei insbesondere der Jahresumsatz, die Anzahl der Mitarbeiter und die Größe des Fuhrparks sein.
8. Das Amtsgericht hat bei der Bemessung der Geldbuße zu Lasten des Betroffenen gewürdigt, dieser sei aufgrund vergangener Bußgeldverfahren bereits sensibilisiert, obwohl sich aus den Feststellungen ’nicht ergibt, dass es gegen den Betroffenen in der Vergangenheit überhaupt weitere Bußgeldverfahren gegeben hat, welcher Vorwurf Gegenstand dieser Verfahren war und ob es zu der Festsetzung von Bußgeldern gekommen ist.“
Auf derselben Linie liegt dann die zweite Entscheidung, der OLG Hamm, Beschl. v. 19.03.2024 – III-4 ORbs 334/23, den ich daher nicht mehr vollständig einstelle.