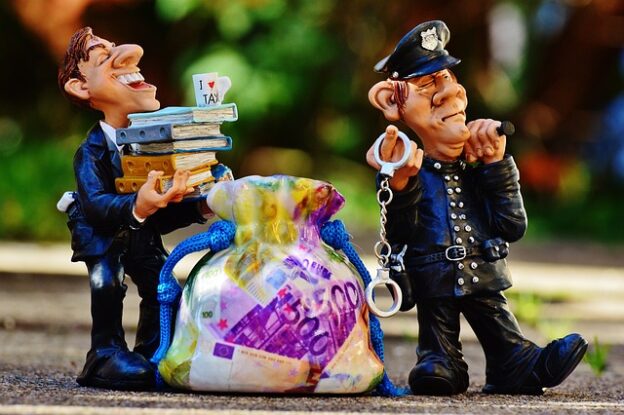Und zum Tages- – und Monatsschluss – dann noch eine Entscheidung, die nicht unmittelbar mit der StPO zu tun hat, sondern mit dem StrEG. Die Ausgangsproblematik liegt aber in der StPO, und zwar:
Der ehemalige Angeklagte wurde im Rahmen eines zunächst gegen andere Beschuldigte geführten Ermittlungsverfahrens am 17.02.2021 wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen und befand sich seit dem 18.02.2021 in Untersuchungshaft, bis er im Oktober 2021 von deren weiterem Vollzug verschont wurde. Hintergrund der Verhaftung war u.a., dass im Rahmen einer Durchsuchung in der von dem ehemaligen Angeklagten mit seinem Bruder, einem Mitbeschuldigten des Ermittlungsverfahrens, gemeinsam bewohnten Wohnung sowie in einem Fahrzeug des Angeklagten Marihuana und an verschiedenen Orten deponiertes Bargeld aufgefunden worden war. Hinsichtlich der in seinem Fahrzeug befindlichen Menge von etwa zwei Kilogramm Marihuana äußerte der Angeklagte im Verlauf der Durchsuchung gegenüber einer Polizeibeamtin dass alles, was in seinem Fahrzeug sei, ihm gehöre.
In der Folgezeit hat die Staatsanwaltschaft gegen den Angeklagten und dessen Bruder Anklage wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Btm in nicht geringer Menge auch hinsichtlich dieser Handelsmenge erhoben. Das LG hat den Angeklagten hiervon – wie auch in Bezug auf eine weitere Tat – mit Urteil vom 19.07.2022 freigesprochen. In diesem Rahmen hat es festgestellt, dass der Angeklagte wegen der erlittenen Untersuchungshaft für die Zeit ab dem 27.05.2021 bis zu der Aufhebung des Haftbefehls – auch soweit dieser im Oktober 2021 außer Vollzug gesetzt wurde – zu entschädigen sei. Für den Zeitraum vom 17.02.2021 bis zum 26.05.2021 hat sie demgegenüber eine Entschädigung versagt. Durch seine Angaben gegenüber der Polizeibeamten habe sich der Angeklagte wahrheitswidrig selbst belastet und die Strafverfolgungsmaßnahme jedenfalls grob fahrlässig verursacht.
Der ehemalige Angeklagte hat gegen diese Entscheidung sofortige Beschwerde eingelegt, mit der er begehrt, auch für den in diesem Zeitraum erlittenen Freiheitsentzug entschädigt zu werden. Zur Begründung trägt er vor, dass die gegenüber der Polizeibeamtin getätigten Angaben einem Verwertungsverbot unterlägen. Das Rechtsmittel hatte beim OLG Kölnmit de, OLG Köln, Beschl. v. 01.08.2023 – 2 Ws 654/22 – Erfolg:
„b) Entgegen der Auffassung des Landgerichts ist eine Entschädigung nicht deshalb ausgeschlossen, weil der Beschwerdeführer den in der Zeit vom 17.02.2021 bis zum 26.05.2021 erlittenen Freiheitsentzug gemäß § 5 Abs. 2 StrEG grob fahrlässig verursacht hatte.
aa) In rechtlicher Hinsicht gilt insoweit:
(1) Ein grob fahrlässiges Verhalten im Sinne von § 5 Abs. 2 StrEG liegt vor, wenn der Beschuldigte die Strafverfolgungsmaßnahme durch sein Verhalten herausgefordert hat. Er muss in ungewöhnlichem Maße die Sorgfalt außer Acht gelassen haben, die ein verständiger Mensch in gleicher Lage anwenden würde, um sich vor Schaden durch die Strafverfolgungsmaßnahme zu schützen (BGH, Beschluss vom 24. September 2009 – 3 StR 350/09 -, Rn. 4, juris). Ob eine derartige schuldhafte Verursachung vorliegt, ist ausschließlich nach zivilrechtlichen Zurechnungsgrundsätzen (§ 254 Abs. 1, §§ 276 bis 278 BGB) zu beurteilen (vgl. KG, Beschuss vom 11.01.2012 – 2 Ws 351/11, juris Rn. 5 mwN). Bei der Beurteilung der Frage, ob der Beschuldigte nach diesen Maßstäben Anlass zu der Strafverfolgungsmaßnahme gegeben hat, ist aufgrund des Ausnahmecharakters des § 5 Abs. 2 StrEG ein strenger Maßstab anzulegen (BGH, Beschluss vom 28.06.2022 – 2 StR 229/21, juris Rn. 20). Es reicht daher nicht aus, dass sich der Freigesprochene irgendwie verdächtig gemacht hat, vielmehr muss er durch eigenes Verhalten einen wesentlichen Ursachenbeitrag zur Begründung des für die Anordnung der Untersuchungshaft erforderlichen dringenden Tatverdachts geleistet haben (BGH, Beschluss vom 24.09.2009 – 3 StR 350/09, juris Rn. 4). In diesem Sinne liegt regelmäßig ein grob fahrlässiges Verhalten vor, wenn sich der Beschuldigte gegenüber den Ermittlungsbehörden wahrheitswidrig selbst belastet (vgl. Abramenko, NStZ 1998, 176, 177). Dies gilt umso mehr, je schwerer der Tatvorwurf ist.
(2) Liegt der entsprechenden Erklärung des Beschuldigten allerdings ein Verstoß gegen die strafprozessuale Belehrungspflicht gemäß § 136 Abs. 1, § 163a StPO zugrunde, rechtfertigt die Selbstbelastung nicht ohne weiteres den Vorwurf einer grob fahrlässigen Verursachung der Strafverfolgungsmaßnahme.
(a) Allerdings wird verbreitet – worauf sich auch das Landgericht bezogen hat – angenommen, dass es für die Feststellung eines grob fahrlässigen Verhaltens unerheblich sein soll, ob hinsichtlich der insoweit maßgeblichen Äußerungen des Beschuldigten ein strafprozessuales Verwertungsverbot wegen Verstoßes gegen die Pflicht zur Beschuldigtenbelehrung besteht, da sich ein solches nur auf den Nachweis des strafrechtlichen Schuldvorwurfes beziehe und die Grundlagen der verfahrensrechtlichen Stellung des Beschuldigten sichern solle. Für die im Rahmen des StrEG zu treffenden Annexentscheidungen könne dieses hingegen jedenfalls keine Fernwirkung dahin entfalten, dass von einem generellen Schweigen des Beschuldigten auszugehen wäre. Da es nicht um die Zuweisung strafrechtlicher Schuld, sondern die Zurechnung nach zivilrechtlichen Maßstäben gehe, liege auch kein Verstoß gegen die Unschuldsvermutung vor (vgl. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 09.07.1997 – 3 Ws 84/96, NStZ 1998, 211; OLG Rostock, Beschluss vom 08.11.2004 – I Ws 269/04, juris Rn. 18; OLG Koblenz, Beschluss vom 22.08.2005 – 2 Ws 507/05, Justizblatt Rh.-Pf. 2005, 223; Burhoff/Kotz, Hdb. für die strafrechtliche Nachsorge, Teil I Rn. 352; MAH Strafverteidigung/Kotz/Arnemann, 3. Aufl., § 29 Rn. 93; Meyer-Goßner/Schmitt/Schmitt, StPO, 66. Aufl., § 6 Rn. 4; MüKoStPO/Kunz StrEG § 5 Rn. 65, § 6 Rn. 5).
(b) Diese Ansicht vermag jedenfalls in ihrer Pauschalität nicht zu überzeugen, soweit hiermit auch die Auffassung verbunden sein sollte, dass der Inhalt von unter Verstoß gegen die Belehrungspflicht zustande gekommenen Erklärungen im Rahmen von Entscheidungen über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen verwertbar sein soll.
(aa) Gemäß § 8 Abs. 1 StrEG ist die Entscheidung über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen dem Strafgericht zugewiesen. Hieraus folgt, dass sich dieses Verfahren nach den Vorschriften der Strafprozessordnung richtet. Bereits dies legt eine einheitliche Behandlung der strafprozessrechtlichen Beweisverwertungsverbote jedenfalls für diejenigen gerichtlich zu treffenden Endentscheidungen nahe, die – wie hier – eine dem Angeklagten belastende Wirkung entfalten können (vgl. Abramenko, NStZ 1998, 176, 177). Dies gilt umso mehr, als die Grundentscheidung über die Entschädigung des Beschuldigten bzw. freigesprochenen Angeklagten nach dem gesetzlichen Leitbild gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 StrEG in dem Urteil oder dem Beschluss, der das Verfahren abschließt, getroffen werden soll; sie ist insoweit Teil des Rechtsfolgenausspruchs (LR/Becker, StPO, 27. Aufl., § 244 Rn. 31). Wäre eine für den Schuld- und Strafausspruch unverwertbare Äußerung des Beschuldigten im Rahmen der Entscheidung nach § 8 Abs. 1 StrEG stets uneingeschränkt verwertbar, müsste sich die Amtsaufklärungspflicht des Gerichts (§ 244 Abs. 2 StPO) auch auf deren Inhalt erstrecken. Das Gericht wäre im Strafprozess daher selbst dann zur Aufklärung des Inhalts der Erklärung verpflichtet, wenn das Bestehen eines Verwertungsverbotes für den Schuld- und Strafausspruch bereits unzweifelhaft feststünde. Dies vermag nicht zu überzeugen.
(bb) Hierfür spricht auch der Zweck der Belehrungspflicht des § 136 Abs. 1 StPO. Das Gesetz setzt die Kenntnis über die Aussagefreiheit beim Bürger nicht voraus, sondern verlangt die ausdrückliche Aufklärung hierüber. Die Belehrungspflicht sichert die verfahrensrechtliche – verfassungsrechtlich garantierte – Stellung des Beschuldigten in elementarer Weise ab (vgl. BGH, Beschluss vom 27.02.1992 – 5 StR 190/91, BGHSt 38, 214, juris Rn. 13 ff.). Aufgrund dessen ist an die unterlassene Belehrung regelmäßig ein strafprozessuales Verwertungsverbot geknüpft (vgl. BGH aaO; LR/Gleß, StPO, 27. Aufl., § 136 Rn. 77). Soweit die verfahrensrechtliche Stellung des Beschuldigten betroffen ist, schützt die Belehrungspflicht den Beschuldigten zwar nicht davor, dass die Strafverfolgungsbehörden gleichwohl gegen ihn gerichtete Ermittlungs- und Strafverfolgungsmaßnahmen treffen. Sie sichert ihn aber (auch) davor, nicht unbedacht an derartigen Maßnahmen mitzuwirken. Gerade dies ist aber – unter anderem – zentraler Gegenstand bei der Frage des Bestehens von Ausschluss- bzw. Versagensgründen nach § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1 Nr. 1 StrEG. Insoweit ist im Übrigen auch in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass Äußerungen des Beschuldigten, denen ein Verstoß gegen die Pflicht zur Belehrung nach § 136 Abs. 1 Satz 2, § 163a Abs. 4 Satz 2 StPO vorangegangen ist, schon im Ermittlungsverfahren im Rahmen der Tatverdachtsprüfung nach § 112 Abs. 1 StPO einem von Amts wegen zu prüfenden Verwertungsverbot unterliegen (vgl. BGH, Beschluss vom 06.06.2019 – StB 14/19, NStZ 2019, 539, Rn. 25 ff.; s. zur Frage der Früh- bzw. Vorauswirkung von Beweisverwertungsverboten auch LR/Mavany, StPO 27. Aufl., § 152 Rn. 33; MüKoStPO/Kölbel StPO § 160 Rn. 37). Dies dient unter anderem auch dem Schutz des Beschuldigten vor auf nicht tragfähiger Grundlage beruhender Strafverfolgungsmaßnahmen und den hiermit einhergehenden Grundrechtseingriffen, die sich im Fall der Freiheitsentziehung überdies als besonders intensiv darstellen.
(cc) Auch materiellrechtlich vermag es nicht zu überzeugen, die trotz unterlassener Belehrung gemachten Angaben des Beschuldigten im Rahmen der Prüfung nach § 5 Abs. 2 StrEG stets inhaltlich zu dessen Nachteil zu berücksichtigen, indem sie als Anknüpfungspunkt für ein grob fahrlässiges Verhalten herangezogen werden. Maßstab für die Frage, ob eine grob fahrlässige Verursachung der Strafverfolgungsmaßnahme vorliegt, ist der objektive Maßstab eines verständigen Menschen in der Lage des Beschuldigten. Setzt das Gesetz die Kenntnis über die Aussagefreiheit beim Bürger aber – wie dargelegt – nicht voraus, so kann im Rahmen der gebotenen objektiven Betrachtung eine Selbstbelastung aber nicht ohne weiteres als die Sorgfalt in ungewöhnlichem Maße außer Acht lassend angesehen werden.
(dd) Soweit in der Verwertung der unter Verstoß gegen die Belehrungspflicht zustande gekommenen Erklärung im Rahmen der nach § 8 Abs. 1 StrEG zu treffenden Grundentscheidung kein Verstoß gegen die Unschuldsvermutung gesehen wird, weil es bei den nach §§ 5, 6 StrEG bestehenden Ausschluss- und Versagungsgründen nur um eine Prüfung nach zivilrechtlichen Zurechnungsgrundsätzen gehe, ist dem insoweit zwar zuzustimmen. Gleichwohl vermag diese Erwägung allein noch nicht zu begründen, weshalb hinsichtlich der Feststellung des Schuldvorwurfs einem Verwertungsverbot unterliegende Äußerungen im Rahmen des Entschädigungsverfahrens nach dem StrEG verwertbar sind. Auch im Zivilprozess besteht insoweit kein uneingeschränktes Verwertungsgebot (vgl. BGH, Urteil vom 10.12.2002 – VI ZR 378/01, NJW 2003, 1123, 1124 f.).
bb) Nach diesen Maßstäben ist vorliegend nicht von einer grob fahrlässigen Verursachung der Anordnung der Untersuchungshaft durch den Beschwerdeführer auszugehen. Angesichts der fehlenden Verwertbarkeit des Inhalts seiner gegenüber der Zeugin D. gemachten Angaben lässt sich schon kein (weiterer) Beitrag des Beschwerdeführers feststellen, der für die Anordnung der Untersuchungshaft ursächlich geworden war. Gegen die Berücksichtigung des Verwertungsverbots spricht insoweit im Übrigen auch nicht, dass der Beschwerdeführer sich mit der einem Verwertungsverbot unterliegenden Äußerung möglicherweise – zum Schutz seines Bruders – wahrheitswidrig selbst belastet hatte. Der Senat entnimmt dem Urteil des Landgerichts insoweit zwar, dass dieses, auch wenn es den Beschwerdeführer hinsichtlich einer Beihilfe zum Handeltreiben nur mit Blick auf den Zweifelssatz freigesprochen hat, aufgrund der in der Hauptverhandlung durchgeführten Beweisaufnahme davon überzeugt gewesen ist, dass das im Fahrzeug des Beschwerdeführers aufgefundene Marihuana nicht diesem, sondern dem gesondert verfolgten C. E. gehört hatte. Es ist aber nicht ausschließen, dass der Beschwerdeführer, wäre er vor seiner Äußerung gegenüber der Zeugin D. ordnungsgemäß belehrt worden, geschwiegen hätte und gegen ihn mangels weiterer tragfähiger Beweismittel kein Haftbefehl ergangen wäre (vgl. zur Anwendung des Zweifelssatzes im Rahmen von § 5 Abs. 2 StrEG: KG, Beschluss vom 08.07.2021 – 5 Ws 104/21, juris Rn. 7 mwN).“