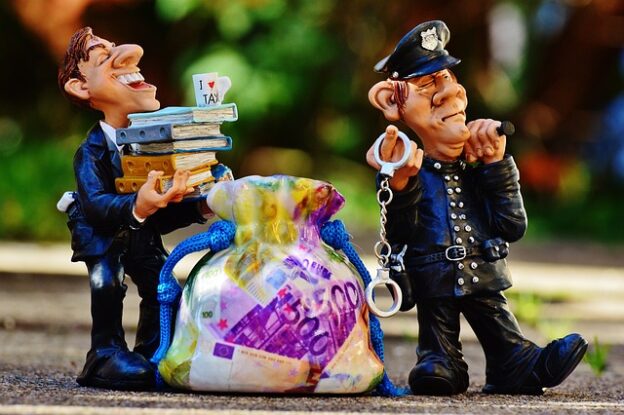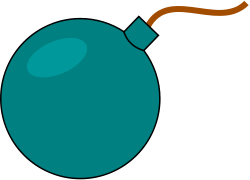Als zweite Entscheidung habe ich dann das OLG Saarbrücken, Urt. v. 12.02.2025 – 5 U 42/24 -, in dem es um die Eintrittspflicht der Beklagten aus einer Fahrzeug-Vollkaskoversicherung geht. Darum wird gestritten.
Dem Vertrag über die Fahrzeug-Vollkaskoversicherung, die der Kläger bei der Beklagten für sein Kfz unterhielt, lagen die Allgemeinen Bedingungen der Beklagten für die Kfz-Versicherung AL_KFZ comfort (AKB 2021 = Anlage B1) zugrunde. Das Fahrzeug des Klägers wurde bei einem Unfall nachts gegen 3.00 Uhr schwer beschädigt. Der Kläger verließ die Unfallstelle und informierte erst zwei Tage später um 18.23 Uhr die Polizei; außerdem will er den Schaden schon am Unfalltag um 8 Uhr telefonisch seinem Versicherungsmakler gemeldet haben.
Ein gegen den Kläger eingeleitetes Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Un-fallort wurde gemäß § 153 StPO eingestellt.
Die Beklagte lehnte die Erstattung des Vollkaskoschadens ab, weil der Kläger sich von der Unfallstelle entfernt und dadurch seine Aufklärungsobliegenheit verletzt habe. Das LG hat dann die Klage im Wesentlichen für begründet erachtet. Auf die Berufung der Beklagten hat das OLG die Klage insgesamt abgewiesen.
Ich stelle auch hier nur die Leitsätze der umfangreich begründeten Entscheidung ein:
1. Zur Obliegenheit des Versicherungsnehmers, nach einem Verkehrsunfall „alles“ zu tun, was zur Feststellung des Versicherungsfalles und des Umfanges der Leistungspflicht erforderlich ist, insbesondere nach Verlassen der Unfallstelle.
2. Das durch § 142 Abs. 2 StGB geschützte Aufklärungsinteresse des Kfz-Versicherers wird zwar durch eine unmittelbar an ihn oder seinen Agenten erfolgende unverzügliche Mitteilung mindestens ebenso gut gewahrt wie durch eine nachträgliche Benachrichtigung des Geschädigten, nicht jedoch durch die (behauptete) Unterrichtung eines als solchen erkennbar nicht der Sphäre des Versicherers zuzurechnenden Versicherungsmaklers, den der Versicherungsnehmer mit der Meldung des Schadens beauftragt und der diese nicht unverzüglich an den Versicherer weitergeleitet hat.
3. Für eine arglistige Verletzung der Aufklärungsobliegenheit kann es sprechen, wenn der Versicherungsnehmer nach einem nächtlichen, nur durch einen erheblichen, auf nicht versicherten Ursachen beruhenden Fahrfehler zu erklärenden Verkehrsunfall keine Unbeteiligten hinzuzieht, das schwer beschädigte Fahrzeug mit Hilfe des herbeigerufenen Bruders des Mitfahrers von der Unfallstelle entfernt, den Vorfall erst zwei Tage später der Polizei meldet, ohne die Verzögerung plausibel zu erläutern und bis zu dem Zeitpunkt, zu dem die erforderlichen Feststellungen hätten nachgeholt werden können, lediglich den Ab-schleppdienst beauftragt und seinen Versicherungsmakler um eine Schadensmeldung bittet, von der ihm bewusst sein musste, dass sie den Versicherer so nur verzögert erreichen würde.