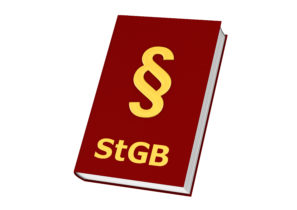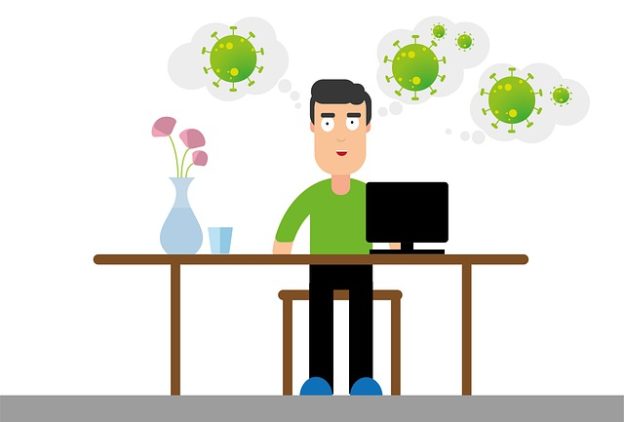Und dann zum Abschluss des Tages noch zwei Entscheidungen, und zwar einmal aus der „Abteilung“ „Gefährdung des demokratischen Rechtsstaates“, und zwar „§ 86a StGB – Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen“ bzw. aus der „Abteilung“ „Straftaten gegen die öffentliche Ordnung“, und zwar „§ 130 StGB – Volksverhetzung“. Von beiden Entscheidungen gibt es aber nur die Leitsätze, die doch rechtlangen Begründungen dann bitte ggf. in den verlinkten Volltexet selbst nachlesen.
Also:
1. Der Wortlaut des § 130 Abs. 3 StGB ist allein auf die Billigung, Leugnung und Verharmlosung von unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenen Taten nach § 6 Abs. 1 VStGB bezogen und umfasst damit den Völkermord, nicht aber die weiteren dem Völkermord vorangegangenen Maßnahmen der Ausgrenzung, Schikanierung und Rechtlosstellung von Juden unter dem nationalsozialistischen Unrechtsregime.
2. Die Verwendung eines verfremdeten sogenannten Judensterns als Kritik an der Situation ungeimpfter Personen unter den Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie (sogenannter Ungeimpft-Stern) verwirklicht nicht den Tatbestand einer Volksverhetzung nach § 130 Abs. 3 StGB, wenn die Verwendung dieses Zeichens nach den tatrichterlichen Feststellungen unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalls auf Maßnahmen der Ausgrenzung, Schikanierung und Rechtlosstellung von Juden bezogen zu verstehen ist, nicht aber auf den an ihnen unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangenen Völkermord.
1. Es ist fraglich, ob es sich dem Slogan „from the river to the sea – Palestine will be free“ um ein Kennzeichen im Sinne des § 86a StGB handelt. Jedenfalls ermangelt es an einem hinreichenden Verdacht dahingehend, dass es sich hierbei um ein solches der HAMAS handelt.
2. Zur Strafbarkeit der Verwendung des Slogans „from the river to the sea – Palestine will be free“ “ (hier verneint)