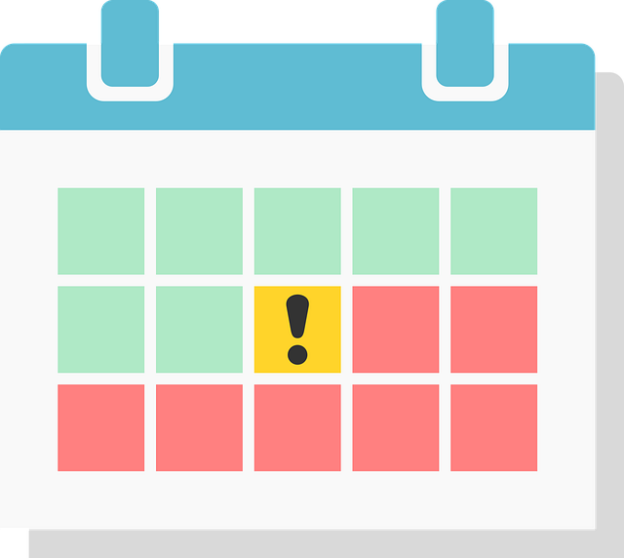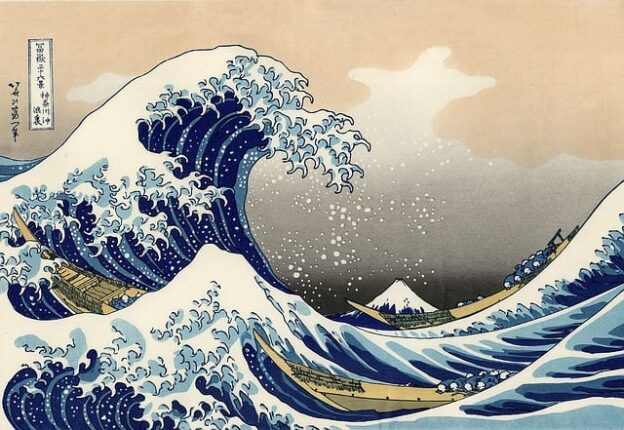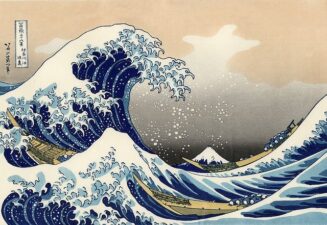Und in die 34. KW. geht es dann mit zwei Entscheidungen zu Zwangsmaßnahmen, und zwar einmal von ganz oben – also BVerfG – und einmal „nur“ von oben, also BGH.
Ich beginne mit dem BVerfG, Beschl. v. 27.06.2024 – 1 BvR 1194/23. Es geht mal wieder um die nicht ausreichende Umgrenzung eines Durchsuchungsbeschlusses. Folgender Sachverhalt:
Die Staatsanwaltschaft führte gegen den Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei. Im November 2022 hatte der Marktleiter eines Baumarkts der Polizei mitgeteilt, dass in letzter Zeit häufiger hochwertige Baumarktartikel gestohlen worden seien. Bei Recherchen im Internet sei er auf einen eBay-Account gestoßen, auf dem u.a. die entwendeten Gegenstände angeboten worden seien. Die Polizei konnte den eBay-Account dem Beschulidgetn zuordnen. In den Wochen vor Einleitung der Ermittlungen waren über diesen Account 69 zum Großteil neuwertige und originalverpackte Baumarktartikel zum Kauf angeboten worden. Eine Liste aller inserierten Artikel wurde zu den Akten genommen.
Am 18.01.2023 ordnete das AG „wegen Hehlerei“ die Durchsuchung der Person, der Wohnung und der sonstigen Räume des Beschwerdeführers an. Die Durchsuchung habe insbesondere den Zweck, als Beweismittel „entwendete Badarmaturen“ und „sonstige entwendete Baumarktartikel“ aufzufinden. Die Beschlagnahme dieser Beweismittel wurde angeordnet. Zur Begründung führte das Amtsgericht aus, dem Beschwerdeführer werde zur Last gelegt, über eBay-Kleinanzeigen unter seinem Account „diverse Artikel“ zum Verkauf anzubieten, die zuvor in dem näher benannten Baumarkt entwendet worden seien. Der Tatverdacht beruhe auf den Online-Ermittlungen der Polizei und der Auskunft des Marktleiters des Baumarktes. Nach den bisherigen Ermittlungen sei zu vermuten, dass die Durchsuchung zur Auffindung von Beweismitteln, die für die Ermittlungen von Bedeutung seien, führen werde. Es folgte eine kurze Feststellung der Verhältnismäßigkeit der Anordnung.
Die Durchsuchung wurde am 26.01.2023 vollzogen. Der Beschuldigte legte Beschwerde gegen den Durchsuchungsbeschluss ein, die vom LG verworfen wurde.
Dagegen dann noch die Verfassungsbeschwerde, die Erfolg hatte. Nach dem üblichen „allgemeinen Vorspann“ führt das BVerfG zur Sache aus:
„b) Danach genügt der Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts den an seine Umgrenzung zu stellenden Anforderungen nicht. Seine Formulierung ist nicht dazu geeignet, sicherzustellen, dass der Eingriff in das Wohnungsgrundrecht des Beschwerdeführers messbar und kontrollierbar blieb.
Der Durchsuchungsbeschluss benennt die gesuchten Beweismittel für sich genommen nicht hinreichend konkret (aa). Eine hinreichende Umgrenzung der gesuchten Beweismittel kann auch der weitere Inhalt des Durchsuchungsbeschlusses nicht leisten, weil er keine für eine hinreichende Umgrenzung ausreichend konkreten Angaben zum tatsächlichen oder rechtlichen Tatvorwurf einschließlich der konkreten vorgeworfenen Vortaten (bb) und insbesondere keinerlei Angaben zum Tatzeitraum (cc) enthält; ebenso fehlen für eine hinreichende Umgrenzung ausreichende Angaben zu Indizien, die den Tatvorwurf trügen (dd). Auch in einer Gesamtschau steckt der Inhalt des Durchsuchungsbeschlusses den äußeren Rahmen der Durchsuchung nicht hinreichend ab (ee). Eine nähere Beschreibung der gesuchten Beweismittel wäre dem Amtsgericht schließlich auch nicht unmöglich oder unzumutbar gewesen (ff).
aa) Der Durchsuchungsbeschluss enthält für sich genommen keine hinreichend konkret umgrenzte Angabe der gesuchten Beweismittel. Diese gibt der Beschluss lediglich mit „entwendete Badarmaturen“ und „sonstige entwendete Baumarktartikel“ an. Dies allein genügt nicht, um dem Beschwerdeführer als Betroffenen und den Ermittlungspersonen präzise aufzuzeigen, wonach gesucht werden sollte. Denn insbesondere die Umschreibung als „sonstige entwendete Baumarktartikel“ ist erheblich zu weit, um die Durchsuchung eines Privathaushalts hinreichend mess- und kontrollierbar zu begrenzen. Umfasst sind ausdrücklich alle Artikel aus dem Sortiment eines Baumarktes. Darunter können eine Vielzahl von Gegenständen in diversen Stückelungen und sehr unterschiedlichen Preiskategorien fallen. Baumärkte verkaufen ein sehr breites und vielfältiges Sortiment. Darüber hinaus lässt die Umschreibung der gesuchten Beweismittel nicht erkennen, ob nur Baumarktartikel gesucht werden, die in einer bestimmten Art und Weise verpackt sind (etwa originalverpackt), einen bestimmten Zustand (etwa neuwertig) aufweisen, einen bestimmten Wert oder eine bestimmte Größe haben oder in einer bestimmten Anzahl aufgefunden werden. Eine solche Umgrenzung wäre insbesondere deshalb erforderlich gewesen, weil zu erwarten ist, dass sich in einem durchschnittlichen Privathaushalt eine Vielzahl von alltäglich genutzten Gegenständen befindet, die im Sortiment eines Baumarktes enthalten sein können und daher von der Beschreibung der gesuchten Beweismittel im Durchsuchungsbeschluss erfasst wären.
bb) Auch die im Durchsuchungsbeschluss enthaltenen Angaben zum Tatvorwurf, dem ihm zugrundeliegenden Lebenssachverhalt oder den für eine Hehlerei erforderlichen Vortaten können die Mängel der Umgrenzung nicht hinreichend kompensieren, um Umfang und Tiefe der Durchsuchung mess- und kontrollierbar zu gestalten. Der Durchsuchungsbeschluss erwähnt weder § 259 Abs. 1 StGB, noch wird die dortige Beschreibung des Straftatbestands der Hehlerei wörtlich zitiert oder wenigstens paraphrasiert. Die einzige Erwähnung der „Hehlerei“ findet sich im Rubrum des Durchsuchungsbeschlusses. Darüber hinaus fehlen Angaben über die konkret entwendeten oder zum Verkauf angebotenen Gegenstände, die möglichen Täter, den möglichen Ablauf und die Anzahl etwaiger Vortaten. Statt einer auf Grundlage der vorhandenen Inserate-Liste oder der Zeugenaussage des Marktleiters formulierten Beschreibung der im Baumarkt entwendeten oder vom Account des Beschwerdeführers aus verkauften Gegenstände spricht der Durchsuchungsbeschluss nur von „diverse[n] Artikeln“. Auch der subjektive Tatbestand (Wissen und Wollen des Verkaufens gestohlener Gegenstände) ist nicht im Ansatz beschrieben. Dem konkreten Tatvorwurf im Durchsuchungsbeschluss lässt sich mangels subjektiven Tatbestands weder eine Verwirklichung eines Strafgesetzes noch eine Vollendung der Tat („zum Verkauf anzubieten“) entnehmen.
cc) Eine hinreichende Umgrenzung des Durchsuchungsbeschlusses ergibt sich auch nicht aus einer etwaigen zeitlichen Eingrenzung des Tatvorwurfs, da eine solche fehlt. Die Formulierung des Tatvorwurfs im Präsens mag darauf hindeuten, dass dem Beschwerdeführer eine noch andauernde Handlung vorgeworfen wird. Das hilft aber über die mangelnde Eingrenzung nicht hinweg, weil nicht erkennbar ist, seit wann das vorgeworfene Handeln andauert (vgl. auch BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Juni 2018 – 2 BvR 1260/16 -, Rn. 31). Die vorgeworfenen Taten sind auch keine Dauerdelikte, so dass es auf ihren Beginn nicht ankäme (vgl. dazu BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 24. Mai 2006 – 2 BvR 1872/05 -, Rn. 11). Vielmehr werden dem Beschwerdeführer mehrere einzelne, aber nicht weiter konkretisierte Hehlereitaten vorgeworfen. Es ist aus dem Durchsuchungsbeschluss nicht einmal erkennbar, ob die vorgeworfenen Taten möglicherweise bereits verjährt sind (vgl. dazu BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Juni 2018 – 2 BvR 1260/16 -, Rn. 31). Das gilt insbesondere insofern, als die Wertung, ab welchem Zeitpunkt Taten in der Vergangenheit möglicherweise verjährt sind, mangels Angaben dazu, ob dem Beschwerdeführer versuchte oder vollendete Delikte als Täter oder Teilnehmer vorgeworfen werden, für Beschwerdeführer und Ermittlungspersonen auf Grundlage des Durchsuchungsbeschlusses nicht möglich ist; selbst aus einer angenommenen zeitlichen Beschränkung des Tatvorwurfs auf nichtverjährte Taten könnte sich daher keine mess- und kontrollierbare Begrenzung ergeben (vgl. BVerfG, Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 4. April 2017 – 2 BvR 2551/12 -, Rn. 25).
dd) Soweit der Durchsuchungsbeschluss einige wenige Indizien (den Namen des verwendeten Accounts, Name und Anschrift des Baumarktes) nennt, können diese hier von vornherein keine mess- und kontrollierbare Umgrenzung der Durchsuchung leisten.
ee) Auch in einer Gesamtschau steckt der Inhalt des Durchsuchungsbeschlusses den äußeren Rahmen der Durchsuchung nicht hinreichend ab. Weder die inhaltliche, zeitliche oder rechtliche Umschreibung des Tatvorwurfs und der Vortaten noch die Benennung der Beweismittel zeigt klar auf, welche Baumarktartikel gesucht werden sollen. Dadurch war es dem Beschwerdeführer auch praktisch nicht möglich, durch die Herausgabe von Gegenständen die Durchsuchung abzuwenden. Denn weder der Beschwerdeführer noch die Ermittlungspersonen hätten abschätzen können, welche Gegenstände der Beschwerdeführer freiwillig herausgeben müsste, um weitere Durchsuchungshandlungen abzuwenden.
ff) Die Anforderungen an eine Umgrenzung der gesuchten Beweismittel waren hier auch nicht deshalb abgesenkt, weil dem Amtsgericht eine nähere Beschreibung nicht möglich oder zumutbar gewesen wäre (vgl. BVerfGE 20, 162 <224>; 42, 212 <220>; 96, 44 <51>; 103, 142 <151>). So gab es zum Zeitpunkt des Erlasses des Durchsuchungsbeschlusses zahlreiche Anhaltspunkte in den Akten, deren Aufnahme in den Durchsuchungsbeschluss den äußeren Rahmen der Durchsuchung hätten begrenzen können – ohne dass die Aufnahme dieser einzelnen Punkte für sich genommen verfassungsrechtlich geboten gewesen wäre. Hervorzuheben ist hier insbesondere die praktisch übliche und im Regelfall unerlässliche (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 28. September 2004 – 2 BvR 2105/03 -, Rn. 11) Nennung des groben Tatzeitraums, die vorliegend eine deutliche Umgrenzung des Durchsuchungsbeschlusses ermöglicht hätte. Die hier fehlende zeitliche Eingrenzung ist nicht mit typischerweise fehlenden Details aufgrund des frühen Stadiums der Ermittlungen zu erklären. Vielmehr hatte die Polizei eine konkrete Auflistung von 69 verdächtigen Verkaufsanzeigen mit Erstellungsdatum zur Akte genommen. Auch die Angaben des Marktleiters als Zeugen, dass es „in den vergangenen Wochen vermehrt zu Diebstählen gekommen sei“, machen jedenfalls eine grobe Eingrenzung des Zeitraums sowohl der Vortaten als auch der konkret vorgeworfenen Hehlereitaten möglich. Auch durch eine bloß beispielhafte Nennung einiger der Artikel aus den 69 dokumentierten Inseraten sowie insbesondere durch eine ausdrückliche Beschränkung auf neuwertige oder originalverpackte Ware hätte sich die Durchsuchung bedeutend besser messen und kontrollieren lassen.
c) Der Beschluss des Landgerichts konnte diesen Mangel nicht heilen. Zwar kann das Beschwerdegericht einzelne Inhalte eines Durchsuchungsbeschlusses ergänzen oder bewerten, die zu einer hinreichenden Umgrenzung beitragen können. Das gilt insbesondere für die Begründung der Annahme eines Tatverdachts, wenn die für die Begründung verwendeten Indizien bereits bei Erlass des Durchsuchungsbeschlusses vorlagen (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 28. April 2003 – 2 BvR 358/03 -, Rn. 19 m.w.N.; Beschluss der 1. Kammer des Zweiten Senats vom 10. September 2010 – 2 BvR 2561/08 -, Rn. 29), oder für Darlegungen zur Verhältnismäßigkeit (vgl. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 28. April 2003 – 2 BvR 358/03 -, Rn. 18). Mängel bei der ermittlungsrichterlich zu verantwortenden Umschreibung des Tatvorwurfs und der zu suchenden Beweismittel können aber, wenn die Durchsuchung – wie hier – bereits stattgefunden hat, im Beschwerdeverfahren nicht mehr geheilt werden. Die Funktion des Richtervorbehalts, eine vorbeugende Kontrolle der Durchsuchung durch eine unabhängige und neutrale Instanz zu gewährleisten, würde andernfalls unterlaufen (vgl. BVerfGK 5, 84 <88>). Auch kann eine Begrenzung der Durchsuchungsmaßnahme, die durch die Formulierung des Durchsuchungsbeschlusses präventiv erreicht werden soll, durch eine erst nach der Durchführung ergehende Entscheidung nicht mehr herbeigeführt werden (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 19. Juni 2018 – 2 BvR 1260/16 -, Rn. 29 m.w.N.).
Dies hat das Landgericht verkannt. Die Zurückweisung der Beschwerde verletzt daher den Beschwerdeführer ebenfalls in seinem Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 GG (vgl. auch Beschlüsse der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 29. Juli 2020 – 2 BvR 1324/15 -, Rn. 30, und vom 19. Juni 2018 – 2 BvR 1260/16 -, Rn. 25, 30).“
Man fragt sich: Wie oft muss sich das BVerfG zu den Fragen denn noch äußern? Das haben wir doch schon alles so oder ähnlich gelesen. Für mich sind solche Entscheidungen von AG eine Unverschämtheit. immerhin geht es um die Unverletztlichkeit der Wohnung. Da wäre ein wenig Sorgfalt und Mühe wohl angebracht.