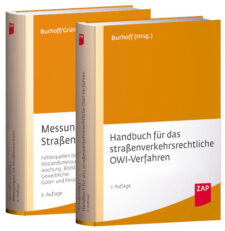Und dann zum Schluss noch ein AG-Beschluss zum Dauerbrennerthema „Akteneinsicht im Bußgeldverfahren“. Ich stelle den Beschluss vor, weil er sich vom Mainstream der OLG-Rechtsprechung wohltuend absetzt und das in Bayern (!!).
Der Verteidiger des Betroffenen, dem eine Geschwindigkeitsüberschreitung zur Last gelegt wird, hat Akteneinsicht beantragt, die nur teilweise gewährt worden ist. Gegen die Versagung der Gewährung von Akteneinsicht ist Antrag auf gerichtliche Entscheidung gemäß § 62 OWiG gestellt worden
Das AG Passau hat im AG Passau, Beschl. v. 13.02.2024 – 4 OWi 749/23 – das bayerische Polizeiverwaltungsamt „angewiesen, dem Verteidiger die mit Antragsschriftssatz vom 16.12.2023 angeforderten Unterlagen in Form des ersten und des letzten Bildes der gesamten Messereihe sowie der jeweils 5 Bilder vor und nach der Messung des Betroffenen im Rahmen einer erneuten Akteneinsicht zur Verfügung zu stellen.“
Begründung:
„Dieser Antrag erweist sich als zulässig und begründet.
Grundsätzlich steht einem Verteidiger ein Akteneinsichtsrecht zu gemäß § 46 I OWiG in Verbindung mit § 147 StPO.
Dieses umfasst regelmäßig lediglich die in der Akte des Bußgeldverfahrens enthaltenen Unterlagen. Das Akteneinsichtsrecht begründet grundsätzlich keinen Anspruch auf Erweiterung des Aktenbestandes.
Ein solcher Anspruch ergibt sich jedoch im vorliegenden Verfahren aus der gesetzlich gebotenen Aufklärungspflicht, denn die im Beschlusstenor genannten Unterlagen sind zur Überprüfung der verfahrensgegenständlichen Messung durch einen Sachverständigen spätestens diesem in der Praxis regelmäßig vorzulegen.
Entgegen der Rechtsansicht des BayObLG verwenden Sachverständige diese Bilder der Messreihe zur Überprüfung einer Geschwindigkeitsmessung regelmäßig und ziehen aus diesen Rückschlüsse auf die Richtigkeit bzw. Unrichtigkeit der Messung, welche sich beispielsweise durch eine im Rahmen des Vergleichs der Messbilder festzustellende Veränderung der Bildeinstellung ergeben kann.“
„Entgegen der Rechtsansicht des BayObLG“ = Ende der Karriere 🙂 .