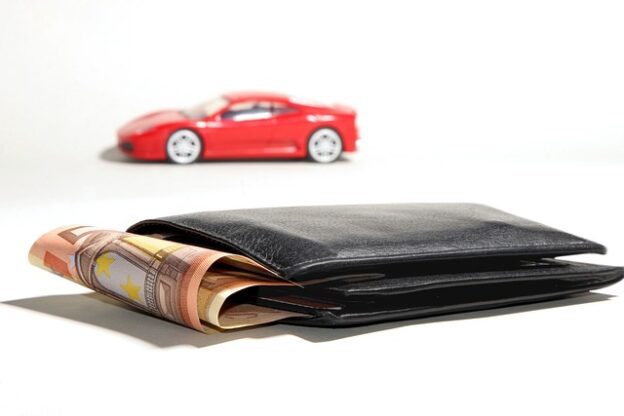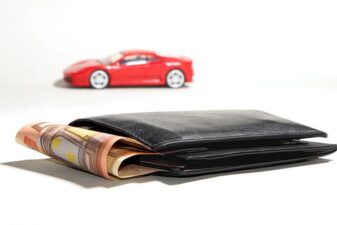Bild von OpenIcons auf Pixabay
Heute am RVG-Tag dann zwei OLG-Entscheidungen zur Pauschgebühr des Pflichtverteidiges (§ 51 RVG). Beide Entscheidungen sind „unschön“.
Ich beginne mit dem OLG Hamm, Beschl. v. 27.02.2024 – 5 AR 7/24 -, der folgenden Sachverhalt hat: Der Kollege, der mir den Beschluss geschickt hat, war Pflichtverteidiger des Angeklagten in einem Verfahren mit dem Vorwurf des Totschlags. Er ist der Verurteilten am 01.11.2017 als Pflichtverteidiger beigeordnet worden. Nach Teilaufhebung eines ersten Urteils und Zurückverweisung durch den BGH verurteilte das LG Bochum die Verurteilte am 25.09.2019 wegen Totschlags. Mit Beschluss vom 12.02.2020 hat der BGH die gegen dieses Urteil gerichtete Revision verworfen.
Mit Schriftsatz vom 14.12.2023, eingegangen beim LG Bochum am selben Tag, hat der Kollege beantragt, ihm eine Pauschvergütung gemäß § 51 RVG zu bewilligen. Beim OLG ging der Antrag nach dem 15.01.2024 ein. Die Vertreterin der Staatskasse hat die Einrede der Verjährung erhoben. Das OLG hat den Antrag zurückgewiesen:
„Der Antrag auf Bewilligung einer Pauschgebühr nach § 51 Abs. 1 S. 1 RVG war
zurückzuweisen, da die von der Vertreterin der Staatskasse erhobene
Verjährungseinrede (§ 214 BGB) durchgreift.
1. Der Anspruch des Pflichtverteidigers auf Bewilligung einer Pauschgebühr verjährt nach allgemeiner Auffassung in entsprechender Anwendung des § 195 BGB in drei Jahren (Beschlüsse des erkennenden Senats vom 23.01.2020 – III 5 RVGs 71/19 und vom 14.07.2014 — III 5 RVGs 57/14; KG Berlin NStZ-RR 2015, 296; OLG Braunschweig NJW-RR 2019, 761; Gerold/Schmidt-Burhoff, 26. Aufl., 2023, § 51 RVG Rn. 52 m.w.N.). Die Verjährungsfristbeginnt hierbei entsprechend § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB in dem Jahr, in welchem der Vergütungsanspruch fällig geworden ist und damit mit rechtskräftigem Abschluss des Verfahrens (OLG Braunschweig NJW-RR 2018, 761; KG Berlin NStZ-RR 2015, 296). Da das dem Vergütungsanspruch zugrundeliegende Verfahren mit der Verwerfung der Revision am 12.02.2020 rechtskräftig abgeschlossen wurde, endete die Verjährungsfrist mit Ablauf des Jahres 2023.
2. Die vorbezeichnete Verjährungsfrist ist durch den Pauschgebührenantrag des Antragstellers vom 14.12.2023 nicht rechtzeitig gehemmt worden. Die Verjährungsfrist wird ausschließlich durch den Eingang des Pauschgebührenantrags bei dem zur Entscheidung berufenen Oberlandesgericht gewahrt, während der Eingang des Antrags bei einem unzuständigen Gericht keinen Einfluss auf Lauf der Verjährung hat (OLG Braunschweig NJW-RR 2019, 761; Gerold/Schmidt- Burhoff, a.a.O., § 51 RVG Rn. 54). Vorliegend ging der Antrag erst am 15.01.2024 und damit nach Ablauf der Verjährungsfrist beim Oberlandesgericht Hamm ein.
3. Die Erhebung der Verjährungseinrede durch die Vertreterin der Staatskasse stellt auch keine unzulässige Rechtsausübung im Sinne von § 242 BGB dar.
a) Eine unzulässige Rechtsausübung ist nur dann anzunehmen, wenn besondere Umstände vorliegen, die die Einrede als groben Verstoß gegen Treu und Glauben erscheinen lassen (Beck’scherOK-Henrich: Stand: 01.02.2023, § 214 BGB Rn. 9). Voraussetzung hierfür ist, dass der Schuldner den Gläubiger durch sein Verhalten objektiv – sei es auch unabsichtlich – davon abgehalten hat, verjährungshemmende Maßnahmen zu ergreifen und die spätere Verjährungseinrede unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls mit dem Gebot von Treu und Glauben unvereinbar wäre (BGH NJW-RR 2022, 740 Rn. 49 m.w.N.). Insofern ist ein strenger Maßstab anzulegen (BGH BeckRS 2018, 31360).
b) Hiervon ausgehend kann vorliegend ein grober Treueverstoß nicht darin erblickt werden, dass das Landgericht Bochum den am 14.12.2023 eingegangenen Antrag nicht verjährungsfristwahrend bis zum 31.12.2023 an das Oberlandesgericht weitergeleitet hat. Da die Prüfung der Verjährungsfrist nicht zu den Aufgaben des Landgerichts gehört, käme ein grober Treueverstoß allenfalls dann in Betracht, wenn sich dem Landgericht die Eilbedürftigkeit der Weiterleitung hätte aufdrängen müssen und es gleichwohl die unverzügliche Weiterleitung des Antrags unterließ. Dies ist indes nicht der Fall. Im Pauschvergütungsantrag wird zum einen nicht auf die Eilbedürftigkeit der Angelegenheit hingewiesen. Zum anderen lagen unter Berücksichtigung der Weihnachtsfeiertage. zwischen Antragseingang und Ablauf der Verjährungsfrist lediglich neun Arbeitstage. Dass in dieser Zeitspanne keine Weiterleitung an das Oberlandesgericht erfolgt, stellt jedenfalls bei mangelndem Hinweis auf die Eilbedürftigkeit keine grobe Treuwidrigkeit dar.“
Dazu folgendes:
1. Die rechtlichen Ausführungen des OLG zum Eintritt der Verjährung und der nicht erfolgten Hemmung des Ablaufs der Verjährungsfrist sind zutreffend. Es ist nun mal herrschende Meinung, dass nur der Eingang des Pauschgebührantrages beim zuständigen OLG die Verjährungsfrist unterbricht (s. auch Burhoff/Volpert/Burhoff, RVG, Straf- und Bußgeldsachen, 6. Aufl., 2021, § 51 Rn 91 ff. mit weiteren Nachweisen). Den Schuh, das übersehen zu haben, muss der Verteidiger sich hier schon anziehen. Auch wenn es sich sonst zur Verfahrensbeschleunigung empfehlen kann, den Pauschgebührantrag nicht beim OLG sondern beim „Tatgericht“ zu stellen, muss man damit – wie dieser Fall schmerzlich zeigt – vorsichtig sein. Denn: Geholfen wird dem Pflichtverteidiger nicht bzw. man lässt keine Milde mit ihm und seinem (vermutlichen) „Irrläufer“ walten.
2. Und dieser Punkt führt dann – zumindest bei mir zur Verärgerung -, und zwar sowohl über die Vertreterin der Staatskasse als auch über das OLG. Dazu stelle ich mir zwei Fragen:
- Zunächst stellt sich schon die Frage, warum die Vertreterin der Staatskasse überhaupt die Einrede der Verjährung erhoben hat. Ich verkenne nicht, dass das natürlich ihr gutes (?) Recht war, aber: Musste das hier sein? Denn der Antrag des Pflichtverteidigers war ja an sich fristwahrend eingegangen, wenn auch beim unzuständigen Gericht. Warum muss man dann, wenn der Antrag gut zwei Wochen später – endlich, dazu gleich mehr – beim zuständigen Gericht eingegangen ist, die Einrede der Verjährung erheben und so die Chance auf eine Pauschgebühr zunichtemachen. Und das alles in Kenntnis des Umstandes, dass das LG/die Justiz mehr als einen Monat gebraucht hat, um den Antrag zum zuständigen OLG zu befördern.
- Und dann das OLG. Ist es wirklich kein „grober Verstoß“? Der Antrag geht 17 Tage vor Ablauf der Verjährungsfrist am 31.12.2023 am 14.12.203 beim LG Bochum ein. Und was macht man dort? Man feiert offenbar vorab schon mal Weihnachten bzw. ist in Weihnachtsurlaub, jedenfalls hält man es nicht für nötig, mal in den Antrag zu schauen, der ja erkennbar nicht in die Zuständigkeit des LG fiel. Hätte man das getan, dann hätte man vielleicht erkannt, dass dieser Antrag schnell noch zum OLG gesandt werden musste, damit er dort noch vor dem 31.12.2023 einging. Es ist richtig, dass die Prüfung der Verjährungsfrist nicht in den Zuständigkeitsbereich des LG fällt. Aber man kann doch wohl von einem Schwurgericht – dort dürfte der Antrag in dem Verfahren mit dem Totschlagsvorwurf eingegangen sein – erwarten, dass es diese Fristen kennt, denn es wird im Zweifel häufiger mit Pauschgebührfragen zu tun haben. Zwischen Eingang des Antrags und Ablauf der Verjährungsfrist lagen immerhin neun Arbeitstage. Also Zeit genug zu prüfen und den Antrag an das OLG zu senden. Beim LG Bochum dürfte man auch über ein Fax verfügen. Zur Not hätte man auch eine Postkutsche beauftragen können und der Antrag wäre im Zweifel immer noch rechtzeitig beim OLG eingegangen. Das alles interessiert das OLG aber nicht bzw. wird mit den Argumenten: Der Verteidiger hat auf den drohenden Fristablauf nicht hingewiesen und schließlich stand Weihnachten vor der Tür, weggewischt.
Ich verkenne nicht, dass der Ursprungsfehler beim Kollegen lag, Aber trotzdem: Ärgerlich.