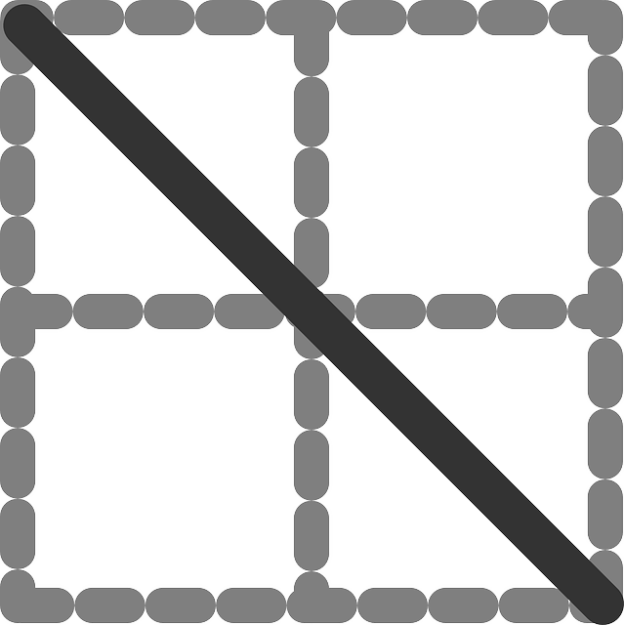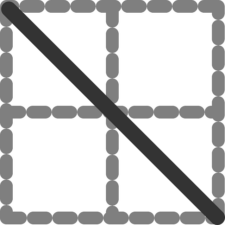Und im dritten Posting mit dem OLG Celle, Beschl. v. 29.05.2024 – 1 Ws 128/24 (StrVollz) – etwas aus dem Strafvollzug, nämlich: Aufrechnung der JVA gegen das Eigengeld des Gefangenen.
Der Antragsteller befindet sich im Vollzug einer Freiheitsstrafe. Mit seinem Antrag auf gerichtliche Entscheidung wendet er sich gegen eine Entscheidung der Antragsgegnerin, mit einer Schadensersatzforderung von 265 EUR gegen sein Eigengeld aufzurechnen. Die Antragsgegnerin begründete diese Forderung damit, dass der Antragsteller einen Schrank in seinem Haftraum zur Anbringung von Regalbrettern angebohrt und dadurch das Anstaltseigentum beschädigt habe.
Die StVK hat den Antrag zurückgewiesen. Dagegen die Rechtsbeschwerde des Gefangenen, die Erfolg hatte:
„2. Die Rechtsbeschwerde ist auch begründet.
a) Die Strafvollstreckungskammer ist zu Recht davon ausgegangen, dass zur Überprüfung der Aufrechnung im gerichtlichen Verfahren gemäß § 109 ff. StVollzG im vorliegenden Fall zunächst das Bestehen des zivilrechtlichen Anspruchs der Antragsgegnerin zu prüfen ist.
Der Senat schließt sich insoweit der überwiegenden Auffassung in Rechtsprechung und Literatur an, wonach die Strafvollstreckungskammer gemäß § 120 Abs. 1 Satz 2 StVollzG i. V. m. § 262 StPO die Möglichkeit hat, entweder über die zivilrechtliche Forderung mitzuentscheiden oder das Verfahren bis zur Entscheidung durch ein Zivilgericht auszusetzen (OLG Naumburg, Beschluss vom 8. September 2015 – 1 Ws (RB) 91/15 –, juris; OLG München, Beschluss vom 17.03.1986 – 1 Ws 1026/85, beck-online; Schmidt-Clarner in: Burhoff/Kotz, Handbuch für die strafrechtliche Nachsorge, Teil C, Rn. 207; Arloth in: Arloth/Krä, 5. Aufl., StVollzG § 93 Rn. 5; Baier/Laubenthal in: Schwind/Böhm/Jehle/Laubenthal, Strafvollzugsgesetze, 7. Aufl., 4. Kapitel, Abschnitt I, Rn. 115). Der Gegenansicht, wonach das Verfahren zwingend ausgesetzt und der Anstalt eine Frist zur Geltendmachung der Forderung vor dem Zivilgericht gesetzt werden muss (OLG Zweibrücken, Beschluss vom 22. Mai 2014 – 1 Ws 83/14 –, juris; KG, Beschluss vom 9. Mai 2003 – 5 Ws 135/03 Vollz –, juris; Bachmann in: Laubenthal/Nestler/Neubacher/Verrel/Baier, Strafvollzugsgesetze, 13. Aufl., Kapitel P, Rn. 24), vermag der Senat bereits aufgrund des Wortlautes von § 262 Abs. 1 und 2 StPO nicht zu folgen. Auch dem Normzweck des § 262 Abs. 2 StPO, der gerade in der Verfahrensökonomie liegt (MüKoStPO/Bartel, 2. Aufl. 2024, StPO § 262 Rn. 2), würde eine Pflicht zur Aussetzung nicht gerecht werden, weil diese zu einer Aufspaltung und Verzögerung des Verfahrens führen würde. Demgegenüber ermöglicht die vom Senat im Einklang mit der vorherrschenden Ansicht vertretene Auffassung eine dem Normzweck entsprechende Ermessensausübung der Strafvollstreckungskammer, bei der die Verfahrensökonomie neben anderen möglicherweise berührten Interessen Berücksichtigung findet.
Einer ausdrücklichen Ausübung des Ermessens der Strafvollstreckungskammer über die Frage der Aussetzung entsprechend § 262 Abs. 2 StPO bedurfte es im vorliegenden Fall nicht. Ihr Ermessen war auf Null reduziert, weil eine Aussetzung zur Klärung des Falles durch ein Zivilgericht hier nicht in Betracht kam. Ist – wie im vorliegenden Fall – die wirtschaftliche Bedeutung des Anspruchs gering und der Sachverhalt einfach gelagert, bedürfte es besonderer Umstände, um das Interesse an einer konzentrierten Bearbeitung des Verfahrens durch die Strafvollstreckungskammer zurücktreten zu lassen. Solche liegen nicht vor.
b) Die Prüfung der zivilrechtlichen Forderung durch die Strafvollstreckungskammer hält rechtlicher Nachprüfung indes nicht stand, weil die Strafvollstreckungskammer keine eigenen Feststellungen zur Schadenshöhe getroffen hat.
Wenn die Strafvollstreckungskammer gemäß § 120 StVollzG i. V. m. § 262 Abs. 1 StPO über die zivilrechtliche Forderung mitentscheidet, muss sich ihre Prüfung sowohl auf den Grund als auch auf die Höhe der Forderung erstrecken (vgl. OLG Naumburg, Beschluss vom 8. September 2015 – 1 Ws (RB) 91/15 –, juris; OLG München, Beschluss vom 17.03.1986 – 1 Ws 1026/85, beck-online; OLG Stuttgart, Beschluss vom 19. Februar 2018 – V 4 Ws 424/17 –, juris). Wie stets im Verfahren nach §§ 109 ff. StVollzG gilt dabei der Untersuchungsgrundsatz. Das Gericht darf seiner Entscheidung nicht den Sachvortrag einer Seite ungeprüft zugrunde legen. Wenn die Vollzugsbehörde Tatsachen vorgetragen hat, die ihre Maßnahme gegenüber dem Gefangenen begründen sollen, muss das Gericht aufklären bzw. erwägen, ob sie zutreffen oder nicht, ehe es sie übernimmt (st. Rspr.; OLG Celle, Beschluss vom 8. September 2020 – 3 Ws 210/20 (MVollz) –, Rn. 19, juris, m. w. N.).
Diesen Anforderungen wird der angefochtene Beschluss nicht gerecht. Die Strafvollstreckungskammer hat darin zur Schadenshöhe lediglich mitgeteilt, dass der Fachbereich Finanzen und Versorgung eine Schadenshöhe von 265 Euro festgesetzt habe. Eine eigene Prüfung, ob diese Schadensbezifferung zutreffend ist, hat sie aber nicht erkennbar vorgenommen.
c) Angesichts des aufgezeigten Rechtsfehlers, der im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht geheilt werden kann, kann der Senat keine eigene Sachentscheidung treffen und hat die Sache zur neuen Entscheidung an die Strafvollstreckungskammer zurückverwiesen (§ 119 Abs. 4 Satz 3 StVollzG).
Auf die erhobenen Verfahrensrügen kommt es daneben nicht mehr an. Deren Zulässigkeit begegnet erheblichen Zweifeln, weil sie sich im Wesentlichen auf ungeordnet in den Schriftsatz hineinkopierte Aktenbestandteile stützt und es nicht Aufgabe des Rechtsbeschwerdegerichtes ist, sich aus einem solchen ungeordneten Vortrag diejenigen Verfahrenstatsachen herauszusuchen, die zu der jeweiligen Rüge passen (vgl. BGH, Urteil vom 26. Oktober 2023 – 5 StR 257/23 –, juris).
Die Strafvollstreckungskammer wird bei ihrer neuen Entscheidung im Übirgen erneut Gelegenheit haben, die Vernehmung der vom Antragsteller benannten Zeugen zu erwägen. Der Senat weist insofern darauf hin, dass die im angefochtenen Beschluss dargelegte Begründung, mit der die Vernehmung der Zeugen abgelehnt wurde, lückenhaft erscheint. Denn die Beschädigung soll nach den Ausführungen der Strafvollstreckungskammer nicht sogleich nach Übergabe des Haftraumes, sondern erst nach mehreren Haftraumkontrollen vor dem 8. Mai 2023 erfolgt sein. Zu diesem Zeitpunkt könnten die Zeugen bereits auf demselben Flur untergebracht gewesen sein.“