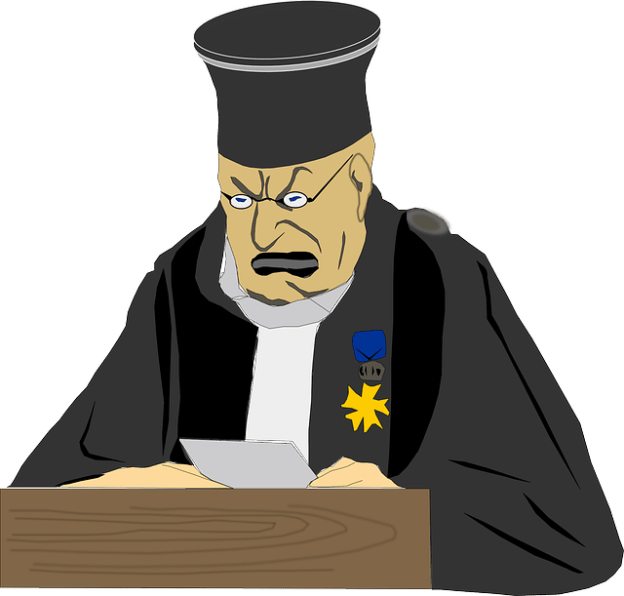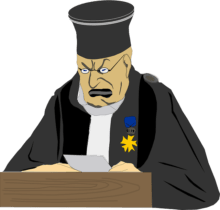Heute dann ein OWi-Tag.
Der BGH hat die Frage nicht beantwortet, sondern hat die Sache an das OLG zurückgegeben, weil nach seiner Ansicht die Vorlegungsvoraussetzungen nicht vorgelegen haben:
„Die Sache ist an das Oberlandesgericht Koblenz zurückzugeben, denn die Vorlegungsvoraussetzungen des § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG i.V.m. § 121 Abs. 2 GVG sind zu verneinen. Der Annahme des Oberlandesgerichts, die dem Bundesgerichtshof vorgelegte Frage sei entscheidungserheblich, liegt die nicht mehr vertretbare rechtliche Bewertung einer Vorfrage zugrunde. Damit ist der Senat an die vom Oberlandesgericht bejahte Entscheidungserheblichkeit nicht gebunden (vgl. hierzu BGH, Beschluss vom 24. Januar 2023 – 3 StR 386/21 Rn. 8, zur Veröffentlichung in BGHSt vorgesehen; Beschluss vom 9. Oktober 2018 – 4 StR 652/17, NStZ-RR 2019, 60, 61; Beschluss vom 17. März 1988 – 1 StR 361/87, BGHSt 35, 238, 240 ff.; Gittermann in Löwe-Rosenberg, StPO, 27. Aufl., § 121 GVG Rn. 78; Feilcke in KK-StPO, 9. Aufl., § 121 GVG Rn. 43 f.; Quentin in SSW-StPO, 5. Aufl., § 121 GVG Rn. 22; jeweils mwN).
1. Die Vorlegungsfrage kann für die Entscheidung des Oberlandesgerichts nur erheblich sein, wenn der Betroffene sein Begehren, Zugang zu den Rohmessdaten der Tagesmessreihe zu erhalten, im behördlichen und gerichtlichen Verfahren in ausreichender Weise geltend gemacht hat (vgl. zu den Anforderungen allgemein etwa KG, Beschluss vom 20. April 2021 – 3 Ws (B) 84/21, juris Rn. 7). Hiervon geht das Oberlandesgericht Koblenz auch aus. Es hat jedoch die rechtliche Bedeutung des Umstands verkannt, dass der Betroffene sein Zugangsgesuch – anders als in den Fällen, die den als divergierend angesehenen Entscheidungen zugrunde lagen (vgl. zudem OLG Stuttgart, VRS 140, 319) – nicht in der Hauptverhandlung erneuert hat. Damit kann seinen Verfahrensrügen, die sich auf die verweigerte Einsichtnahme in die Rohmessdaten stützen, von vornherein kein Erfolg beschieden sein. Sollte das Rechtsbeschwerdevorbringen im Hinblick auf das Prozessgeschehen in der Hauptverhandlung nicht bereits als unzureichend anzusehen sein (vgl. § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG, § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO), wären die Rügen jedenfalls unbegründet. Dies ergibt sich aus Folgendem:
a) Die Verfahrensrüge einer unzulässigen Beschränkung der Verteidigung (§ 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG, § 338 Nr. 8 StPO) kann nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur durchgreifen, wenn Verteidigungsrechte durch einen Gerichtsbeschluss in der Hauptverhandlung verletzt worden sind (vgl. BGH, Beschluss vom 14. Oktober 2020 – 5 StR 229/19, NJW 2021, 1252, 1255; Beschluss vom 17. Juli 2008 ? 3 StR 250/08, BGHR StPO § 338 Nr. 8 Beschränkung 9; Urteil vom 10. November 1967 – 4 StR 512/66, BGHSt 21, 334, 359). Ein solcher ist hier nicht ergangen. Es kann zwar auch ausreichen, wenn das Gericht es unterlässt, einen in der Hauptverhandlung gestellten Antrag zu bescheiden (vgl. BGH, Beschluss vom 17. Juli 2008 – 3 StR 250/08, NStZ 2009, 51; KK-StPO/Gericke, 9. Aufl., § 338 Rn. 102). Auch daran fehlt es im vorliegenden Fall jedoch, da die für den Betroffenen in der Hauptverhandlung anwesende Verteidigerin dort keinen auf die Zugänglichmachung der Rohmessdaten abzielenden Antrag stellte, sondern vielmehr ausdrücklich erklärte, die Ordnungsgemäßheit der Messung nicht zu bestreiten.
b) Die Rüge, der Grundsatz des fairen Verfahrens (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 6 Abs. 1 Satz 1 MRK) sei verletzt, versagt ebenfalls, wenn das Einsichtsersuchen nicht (auch) in der Hauptverhandlung geltend gemacht wird. Dies liegt – ohne dass es auf die Frage ankäme, ob nicht insoweit ohnehin § 338 Nr. 8 StPO anzuwenden ist (vgl. OLG Brandenburg, ZfSch 2021, 469; OLG Saarbrücken, Beschluss vom 24. Februar 2016 – Ss (Bs) 6/2016 (4/16 OWi), juris Rn. 8) – schon im Grundsatz der Verfahrensfairness selbst begründet.
aa) Das Recht auf ein faires Verfahren ist erst verletzt, wenn bei einer Gesamtschau rechtsstaatlich zwingende Folgerungen nicht gezogen worden sind oder rechtsstaatlich Unverzichtbares preisgegeben wurde (vgl. BVerfGE 133, 168, 200; BVerfGE 130, 1, 25 f.; OLG Karlsruhe, NZV 2020, 368). Ein Verstoß gegen den auf die Gesamtheit des Verfahrens abhebenden Fairnessgrundsatz (vgl. EGMR, NJW 2019, 1999; NJW 2017, 2811, 2812; BVerfG, NJW 2021, 455 Rn. 33, 35) kommt daher bei verweigerter Einsichtnahme in Rohmessdaten nur dann in Betracht, wenn einem rechtzeitig und unter Ausschöpfung aller prozessualen Möglichkeiten angebrachten Zugangsgesuch nicht entsprochen worden ist (vgl. KG, Beschluss vom 20. April 2021 – 3 Ws (B) 84/21, juris Rn. 7; Thüringer Oberlandesgericht, VRS 140, 33, 35).
bb) Nach diesen Maßgaben muss der Betroffene, will er mit der Rechtsbeschwerde einen Verstoß gegen die Verfahrensfairness rügen, den Zugang zu nicht zur Akte genommenen Informationen nicht nur bereits im Bußgeldverfahren und im Verfahren nach § 62 OWiG begehren (so KG Berlin, Beschluss vom 20. April 2021 – 3 Ws (B) 84/21, juris Rn. 7 mwN; OLG Koblenz, BeckRS 2020, 10860 Rn. 7; s. ferner BVerfG, NJW 2021, 455 Rn. 60, 66), sondern sein Einsichtsbegehren auch in der Hauptverhandlung weiterverfolgen (vgl. hierzu VerfGH Saarland, NZV 2018, 275 Rn. 35, 38; OLG Brandenburg, ZfSch 2021, 469; OLG Saarbrücken, Beschluss vom 24. Februar 2016 – Ss (Bs) 6/2016 (4/16 OWi), juris Rn. 8; jeweils mwN; Hannich, FS Fischer 2018, S. 655, 658; s. zudem BVerfG, NJW 2021, 455 Rn. 66). Im Blick auf die gebotene Gesamtschau kann die Fairness des Ordnungswidrigkeitenverfahrens überhaupt nur in Frage stehen, wenn der (verteidigte) Betroffene die Einsicht in die Rohmessdaten auch mithilfe eines in der Hauptverhandlung gestellten Antrags begehrt hat. Denn bei dieser handelt es sich um den maßgeblichen Verfahrensabschnitt für die tatrichterliche Sachentscheidung, die der Betroffene durch seinen Einspruch herbeiführt. Das Gericht trifft seine Entscheidung allein aufgrund des Inbegriffs der Hauptverhandlung (vgl. § 46 Abs. 1 OWiG, § 261 StPO).
Der Betroffene hat es hier versäumt, sein Informationszugangsersuchen in der Hauptverhandlung geltend zu machen. Aus den zuvor genannten Gründen genügt – anders als das Oberlandesgericht Koblenz annimmt – sein beim Amtsgericht vor der Hauptverhandlung gestelltes Einsichtsgesuch nicht, um eine Verletzung des Fairnessgrundsatzes mit Erfolg rügen zu können. Hieran ändert § 336 Satz 1 StPO nichts (vgl. auch zur Akteneinsicht BGH, Urteil vom 24. Mai 1955 – 5 StR 155/55; OLG Hamm, NJW 1972, 1096). Denn diese Vorschrift entbindet das Rechtsbeschwerdegericht bei der Prüfung der als verletzt gerügten Verfahrensfairness nicht davon, die Gesamtheit des Verfahrens in den Blick zu nehmen.
2. Damit kommt es nicht mehr darauf an, dass ein von dem vorlegenden Oberlandesgericht womöglich befürworteter Rechtssatz des Inhalts, dass bei einem standardisierten Messverfahren die Persönlichkeitsrechte Dritter und die Funktionstüchtigkeit der Rechtspflege dem Informationsinteresse des Betroffenen an der Tagesmessreihe generell vorgehen, mit den bindenden verfassungsgerichtlichen Vorgaben einer Einzelfallprüfung (vgl. BVerfG, NJW 2021, 455 Rn. 58) unvereinbar sein könnte. Sollte den begehrten Informationen nach der zulässigen (individuellen) gerichtlichen Überprüfung des Gesuchs die Verteidigungsrelevanz abzusprechen sein (vgl. dazu BVerfG, NJW 2021, 455 Rn. 56 ff.), wohin auch das Oberlandesgericht Koblenz nach dem Vorlagebeschluss zumindest tendiert, scheidet allerdings schon deshalb ein Zugangsanspruch des Betroffenen aus (vgl. BGH, Beschluss vom 30. März 2022 – 4 StR 181/21, NZV 2022, 287 Rn. 9; OLG Zweibrücken, BeckRS 2022, 15436 Rn. 16).“