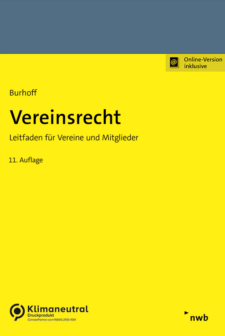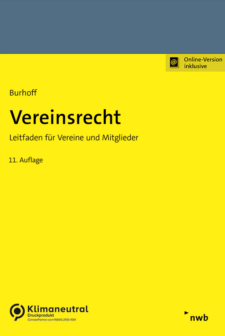 Und dann heute der „Kessel Buntes“. In dem wird es heute zu Beginn ganz bunt 🙂 . Denn ich stelle mal eine vereinsrechtliche Entscheidung vor. Natürlich mit einem Hintergedanken. Achtung!! Werbung!! – nämlich für mein Vereinsrechtsbuch, das es inzwischen in der 11. Auflage gibt.
Und dann heute der „Kessel Buntes“. In dem wird es heute zu Beginn ganz bunt 🙂 . Denn ich stelle mal eine vereinsrechtliche Entscheidung vor. Natürlich mit einem Hintergedanken. Achtung!! Werbung!! – nämlich für mein Vereinsrechtsbuch, das es inzwischen in der 11. Auflage gibt.
Hier also zunächst das OLG Hamm, Urt. v. 26.04.2023 – 8 U 94/22 – mit folgendem Sachverhalt:
Der Kläger ist Miglieder im beklagten Verein. Als dessen Mitglied begehrt der Kläger von dem Verein die Übergabe einer Liste der Mitglieder des Vereins mit näher bezeichneten Angaben an sich selbst. Das OLG stellt fest:
„1.Der Kläger ist eines von etwa 5.500 Mitgliedern des Beklagten, einem eingetragenen Verein. Der Beklagte verfolgt den Zweck, die Interessen seiner Mitglieder, die an Unternehmen der Q.-Unternehmensgruppe beteiligt sind, zu vertreten (§ 2 Abs. 2 Satzung, Anlage K 1). Der Zweck des Vereins wird insbesondere verwirklicht durch die Unterstützung des klimaschützenden Umbaus der Energieversorgung, speziell die Förderung regenerativer Energien auf Basis von genossenschaftlichen oder rechtlich vergleichbaren Gesellschaftsformen (§ 2 Abs. 3 Satzung).
Die Satzung des Beklagten nimmt wiederholt auf die Möglichkeit einer Kommunikation des Beklagten mit seinen Mitgliedern per E-Mail Bezug. Eine ausdrückliche Verpflichtung der Mitglieder, eine E-Mail-Adresse mitzuteilen, sieht die Satzung des Beklagten nicht vor. Der Beklagte kommuniziert mit seinen Mitgliedern selbst auch per E-Mail (Bl. 6 eGA I). Der Beklagte stellt den Mitgliedern im Internet einen Mitgliederbereich zur Verfügung. Die Vereinsmitglieder können dort Gruppen einrichten und ihre Konzepte bzw. Vorschläge veröffentlichen. Die Einträge in diesem Bereich kontrolliert der Beklagte insofern, als er dort lediglich sachlich gehaltene Beiträge zulässt.
Der Kläger hatte in Vorbereitung der Mitgliederversammlung des Beklagten 2021 das Anliegen, mit den anderen Mitgliedern des Beklagten in Kontakt zu treten, um eine Opposition gegen das Vorgehen des Vorstands des Beklagten zu organisieren. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung 2021 hatte er das Anliegen, mit den anderen Mitgliedern in Kontakt zu treten, um ggf. die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu initiieren (§ 37 Abs. 1 BGB). Der Kläger verfolgt auch weiterhin das Interesse, mit den anderen Mitgliedern des Vereins im Hinblick auf die derzeitige „Vereinspolitik“ in Kontakt zu treten, um die aktuelle Meinungsbildung zu beeinflussen.
Außer dem Kläger haben nach Auskunft des Vorstandsmitglieds des Beklagten in der mündlichen Verhandlung bislang keine anderen Mitglieder einen Antrag auf Übergabe der Mitgliederliste gestellt, um mit Kon-Mitgliedern in Kontakt zu treten.
Der Kläger hat die Ansicht vertreten, er habe einen Anspruch auf Übermittlung einer Mitgliederliste mit Namen, Adressen und E-Mail-Adressen unmittelbar an sich – ohne die Einschaltung eines Treuhänders -, um mit den weiteren Vereinsmitgliedern eigenständig in Verbindung und Diskussion zu treten.“
Das LG hat die Klage abgewiesen. Zur Begründung hat es im Wesentlichen Folgendes ausgeführt: „Dem Interesse des Klägers stünden überwiegende Interessen des Beklagten und Belange seiner Mitglieder entgegen. Die Mitglieder könnten darauf vertrauen, nicht von anderen Mitgliedern über andere als die vom Verein bereitgestellten Kommunikationskanäle kontaktiert zu werden. Sie müssten nicht damit rechnen, dass der Beklagte ihre E-Mail-Adresse weitergeben. Die Belästigung durch E-Mail sei besonders hoch. Das ergebe sich auch aus der gesetzgeberischen Wertung des § 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG. Das gelte besonders mit Blick darauf, dass bei der (vom Landgericht noch mit 7.000 angenommenen) Mitgliederzahl des Beklagten jedes Mitglied potentiell mit 7.000 E-Mails rechnen müsste. Dem Kläger gegenüber sei das nicht unbillig. Ihm stünden die Kommunikationsmöglichkeiten auf der Website des Beklagten zur Verfügung. Auch die Möglichkeit der Übermittlung der Kontaktdaten an einen Treuhänder – die der Kläger nicht beantragt habe – sei ein milderes Mittel, den berechtigten Interessen des Klägers Rechnung zu tragen. Die anderslautende Rechtsprechung, die der Kläger zitiert habe, betreffe Gesellschaften, und dort sei die Situation anders. Auf die Frage, ob der Kläger auch die Übermittlung der E-Mail-Adressen beanspruchen könne, komme es nicht an, da der Kläger schon keinen Anspruch auf die – von ihm allein begehrte – Übermittlung von Mitgliederdaten an sich selbst habe. Auch die Frage, ob die Übermittlung einer Mitgliederliste mit dem Datenschutzrecht vereinbar sei, könne dahinstehen.“
Dagegen die Berufung des Klägers, die beim OLG Erfolg hatte.
Ich stelle hier nur die Leitsätze ein. Wegen der Einzelheiten der – umfangreichen – Begründung verweise ich auf den Volltext. Hier die Leitsätze:
-
- Einem Vereinsmitglied steht ein aus dem Mitgliedschaftsverhältnis fließendes Recht gegen den Verein auf Übermittlung einer Mitgliederliste zu, die auch E-Mail-Adressen der Mitglieder enthält, soweit es ein berechtigtes Interesse hat und dem keine überwiegenden Geheimhaltungsinteressen des Vereins oder berechtigte Belange der Vereinsmitglieder entgegenstehen.
- Ein berechtigtes Interesse an dem Erhalt der Mitgliederliste ist u. a. dann gegeben, wenn eine Kontaktaufnahme mit anderen Vereinsmitgliedern beabsichtigt ist, um eine Opposition gegen die vom Vorstand eingeschlagene Richtung der Vereinsführung zu organisieren.
- Das Vereinsmitglied kann in dem Fall nicht auf ein vom Verein eingerichtetes Internetforum verwiesen werden; es ist auch nicht auf die Auskunftserteilung an einen Treuhänder beschränkt.
- Der Beitritt zu einem Verein begründet die Vermutung, auch zu der damit einhergehenden Kommunikation – auch per E-Mail – bereit zu sein. Eine erhebliche Belästigung geht damit regelmäßig nicht einher, zumal jedes Vereinsmitglied sich vor dem Erhalt unerwünschter E-Mails schützen kann.
- Die Übermittlung von Mitgliederlisten ist mit dem Datenschutz vereinbar. Sie ist von dem Erlaubnistatbestand des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DGSVO gedeckt.
Und dann <<Werbemodus an>> der Hinweis auf Burhoff, Vereinsrecht Leitfaden für Vereine und Mitgleider, 11. Aufl. 2023, das man hier bestellen kann. <<Werbemodus aus>>.
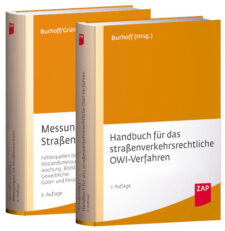 Und dann im zweiten Posting drei Entscheidungen zur Akteneinsicht, Stichwort: Messserie u.a. Nichts Weltbewegendes, aber zwischendurch kann man ja mal wieder über die Problematik berichten. Denn ausgestanden sind die Dinge/Fragen nicht.
Und dann im zweiten Posting drei Entscheidungen zur Akteneinsicht, Stichwort: Messserie u.a. Nichts Weltbewegendes, aber zwischendurch kann man ja mal wieder über die Problematik berichten. Denn ausgestanden sind die Dinge/Fragen nicht.