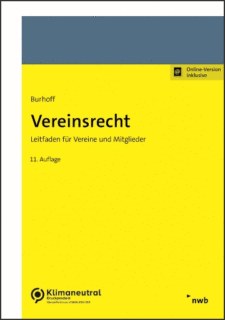Das LG hat den Antrag des Klägers auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen. Hiergegen richtet sich die Berufung des Klägers, die keinen Erfolg hatte:
„Das Landgericht hat im Ergebnis zutreffend den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückgewiesen, denn dem Kläger steht weder ein Verfügungsanspruch (1.) noch ein Verfügungsgrund (2.) zur Seite.
Die Nichtigkeit von Beschlüssen eines Vereins ist im Wege der Feststellungsklage gemäß § 256 ZPO geltend zu machen (Ellenberger, in: Grüneberg, 82. Aufl. 2023, § 32 Rn. 11). Demzufolge ist auch der prozessuale Weg eines Antrages auf Erlass einer einstweiligen Verfügung eröffnet, im einstweiligen Verfügungsverfahren jedoch nur nach Maßgabe der zuletzt im Termin der mündlichen Verhandlung vom 5. Oktober 2023 gestellten Anträge. Denn die Feststellung der Nichtigkeit des Beschlusses der Mitgliederversammlung des Beklagten vom 22. Oktober 2022 zur Abberufung des Klägers als 2. Vorsitzender des Beklagten nähme die Hauptsache vorweg, was nicht zulässig ist. Im einstweiligen Verfügungsverfahren kann aber entschieden werden, dass bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache ein Beschluss keine Wirkungen entfaltet.
Der Kläger dringt jedoch auch mit den aktualisierten Anträgen nicht durch, weder mit den Haupt- noch mit den Hilfsanträgen. Es fehlt sowohl am Verfügungsanspruch als auch an einem Verfügungsgrund i.S.d. §§ 935, 940 ZPO.
Das Landgericht geht in der angefochtenen Entscheidung zutreffend davon aus, dass ein Verfügungsanspruch nicht vorliegt, weil der am 22. Oktober 2022 in der Mitgliederversammlung des Verfügungsbeklagten unter Tagungsordnungspunkt 3 gefasste Beschluss (Amtsenthebung von Herrn pp. als 2. Vorsitzenden) wirksam ist.
Die Nichtigkeit eines Beschlusses eines Vereins (§ 32 BGB) kann vorliegen bei Nichtladung eines Teils der Mitglieder (BGH 59, 369, NJW-RR 06, 831, BayObLG NJW-RR 97, 289). Mängel der Beschlussfassung eines Vereins sind jedoch weder direkt noch analog nach §§ 241 ff. AktG oder nach § 51 GenG zu beurteilen (BGH, Urteil vom 2. Juli 2007, II ZR 111/05, NJW 2008, 69 Tz 36).
Der streitige Beschluss ist nicht schon deshalb unwirksam, weil der insoweit darlegungs- und beweispflichtige Beklagte den (rechtzeitige) Zugang der Ladung zur Mitgliederversammlung am 22. Oktober 2022 beim Kläger nicht bewiesen hat. Der Mangel der Ladung ist im vorliegenden Fall durch die unstreitige persönliche Anwesenheit des Klägers in der Mitgliederversammlung vom 22. Oktober 2022 und seine dortige Mitwirkung geheilt.
Eine ordnungsgemäße Ladung zu einer Mitgliederversammlung erfordert, dass der Gegenstand der Beschlussfassung in der Einladung zu einer Mitgliederversammlung so genau bestimmt ist, dass den Mitgliedern eine sachgerechte Vorbereitung der Versammlung und eine Entscheidung, ob sie an der Versammlung teilnehmen wollen, möglich ist (BGH vom 2. Juli 2007, II ZR 111/05, Rn 38, juris,). Eine Heilung ist möglich, wenn dem nicht ordnungsgemäß geladenen Mitglied der Gegenstand der Beschlussfassung auch ohne Ladung rechtzeitig bekannt wurde. Ferner führt ein Verfahrensfehler nur dann zur Ungültigkeit eines Beschlusses, wenn er für das Abstimmungsergebnis für die Ausübung der Mitwirkungsrechte relevant wurde. Dabei ist auf ein objektiv urteilendes Verbandsmitglied abzustellen (BGH, a.a.O., Rn. 44 unter Verweis auf BGHZ 385, 391 f.; 153, 32, 37). Im vorliegenden Fall kann der Senat nicht erkennen, dass die mangelhafte Ladung des Klägers für das Abstimmungsergebnis relevant wurde, wobei dem Senat bewusst ist, dass die Darlegungs- und Beweislast für die Irrelevanz beim Beklagten liegt.
Dem Kläger war die Zeit und die Tagesordnung der Versammlung vom 22. Oktober 2022 aus dem Protokoll der Vorstandssitzung vom 17. September 2022 bekannt. Dieses Protokoll hat er unstreitig erhalten. Er wusste somit, dass seine Abwahl als 2. Vorsitzender und ggf. die Nachwahl des 2. Vorsitzenden auf der Tagesordnung standen und er hatte Gelegenheit, sich gerade hierauf vorzubereiten. Soweit der Kläger mit der Berufungsbegründung in diesem Zusammenhang vorträgt, „Wären dem Berufungskläger die Tagesordnungspunkte der (außerordentlichen) Mitgliederversammlung – wie sie durchgeführt worden ist – sowie die ihm gegenüber erhobenen Vorwürfe im Einzelnen bekannt gewesen und hätten ihm als Vorbereitung auf diese Versammlung jedenfalls die satzungsmäßigen 14 Tage zur Verfügung gestanden, wäre in der Versammlung möglicherweise anders abgestimmt worden. Zum einen wären dem Antragsteller (bei Kenntnis der genauen Vorwürfe) insbesondere bei entsprechender Vorbereitungszeit in Kenntnis der Einzelheiten Gespräche mit den übrigen Vereinsmitgliedern, auch denjenigen, die zur Versammlung nicht erschienen sind, möglich gewesen, deren Ergebnisse möglicherweise die Willensbildung und somit die Stimmabgabe der übrigen Mitglieder beeinflusst hätten. Zum anderen hätte der Antragsteller die Versammlung bei Kenntnis der Einzelheiten zu den Vorwürfen und bei mehr (Vorbereitungs-) Zeit gewissenhafter vorbereiten und letztlich durch entsprechende Redebeiträge und Anträge in der Versammlung maßgeblichen Einfluss auf die Willensbildung und die Stimmabgabe der Mitglieder nehmen können. All dieses war ihm verwehrt. …“, vermag dieser Vortrag der Berufung nicht zum Erfolg zu verhelfen. Denn schon dem Vorstandsbeschluss vom 17. September 2022 waren mehrfach Unstimmigkeiten zwischen dem Kläger und dem Vorstand sowie den Vereinsmitgliedern vorausgegangen, welche das Verhalten des Klägers, insbesondere die Verwendung von Vereinsvermögen zum Gegenstand hatten. Auch in der Berufungsverhandlung ist nicht ersichtlich geworden, dass in der Versammlung vom 22. Oktober 2022 neue Vorwürfe gegen den Kläger Gegenstand der Diskussion geworden wären. Auch wäre es dem Kläger mit der unstreitigen Übersendung des Protokolls des Vorstandes vom 17. September 2022 möglich gewesen, Kontakt zu jedem Mitglied des Beklagten – der Verein hat insgesamt nur 17 Mitglieder – aufzunehmen und mit diesen Gespräche zu führen. Davon hat der Kläger offensichtlich keinen Gebrauch gemacht, jedenfalls lässt sich dem Vortrag des Klägers nicht entnehmen, dass er insoweit – vergebliche – Versuche unternommen hat.
Der Kläger kann eine Nichtigkeit des Beschlusses der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 22. Oktober 2022 auch nicht darauf stützen, dass kein wichtiger Grund für seine Abberufung vorläge. Gemäß § 27 Abs. 2 S. 2 BGB kann durch die Satzung vom Grundsatz der freien Widerruflichkeit der Vorstandsbestellung abgewichen und die Widerruflichkeit auf den Fall beschränkt werden, dass ein wichtiger Grund vorliegt. Eine solche Beschränkung sieht die Satzung des Beklagten nicht vor. Da der Kläger jedoch für eine bestimmte Amtszeit zum 2. Vorsitzenden bestimmt wurde, darf er grundsätzlich darauf vertrauen, während der laufenden Periode nicht ohne wichtigen Grund abberufen zu werden.
Ein wichtiger Grund für die Abberufung ist nach einhelliger Auffassung gegeben, wenn dem Verein eine Fortsetzung des Organverhältnisses mit dem Vorstandsmitglied bis zum Ende seiner Amtszeit nicht zugemutet werden kann (BeckOGK/Segna, 1.12.2022, BGB § 27 Rn. 4446.1; Staudinger/Schwennicke, 2019, Rn. 55; Soergel/Hadding Rn. 18; Wagner in Reichert/Schimke/Dauernheim Vereins- und VerbandsR-HdB Kap. 2 Rn. 2200). Ein solcher Fall liegt hier vor, weil das Verhältnis des Klägers zu den übrigen Vorstandsmitgliedern so gestört ist, dass eine konstruktive Zusammenarbeit ganz offensichtlich nicht mehr möglich ist. Dabei kommt es auf die Gründe für die Zerrüttung, die auch in der Berufungsverhandlung deutlich zu Tage getreten ist, nicht entscheidend an. Die Zerstörung der Vertrauensbeziehung im Vorstand war erkennbar Grund für die Absicht des Vorstandes des Beklagten, über die Abberufung des Klägers abstimmen zu lassen.
Auch der weitere Vortrag des Klägers, wonach die Verweigerung der Teilnahme und des Rederechts des gemäß § 11 Abs. 3 S. 3 der Satzung des Deutschen pp. e. V. von dessen Präsidium bevollmächtigte Herr Giersch in der Versammlung vom 22. Oktober 2022 zur Nichtigkeit der dort gefassten Beschlüsse führe, verhilft der Berufung nicht zum Erfolg. Es ist nicht ersichtlich, dass die Verweigerung der Teilnahme und des Rederechts des Herrn pp.3 durch den Mangel der Ladung des Klägers zu der Mitgliederversammlung vom 22. Oktober 2022 verursacht wurde. Auch bildet diese Verweigerung keinen eigenständigen Grund für die Nichtigkeit des Beschlusses über die Abberufung des Klägers. Der Beklagte hat mit der Verweigerung zweifelsohne gegen seine Pflicht als Mitglied des Deutschen pp. e.V., dessen Vertreter in der Mitgliederversammlung ein Rederecht einzuräumen, verstoßen (§ 11 Abs. 3 S. 3 der Satzung des Deutschen pp. e. V). Daraus folgt aber nicht ohne Weiteres die Verletzung eines Mitgliedsrechts des Klägers.
Auch der Hauptantrag zu A 2.a), wonach der Beschluss des Beklagten aus der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 22. Oktober 2022, durch Nachwahl des 2. Vorsitzenden nunmehr Herrn pp.2 als neuen 2. Vorsitzenden des Berufungsbeklagten zu berufen, bis zur rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache keine Wirkungen entfalten soll, ist aus den vorgenannten Ausführungen unbegründet. Dies gilt auch für den Hauptantrag zu A 2.b).
Mit seinen Hilfsanträgen im Übrigen vermag der Kläger aus den vorgenannten Gründen ebenfalls nicht durchzudringen.
Selbst unter Annahme des Vorliegens eines Verfügungsanspruches scheitert die Berufung jedenfalls daran, dass der Kläger einen Verfügungsgrund nicht glaubhaft gemacht hat, § 940 ZPO……“