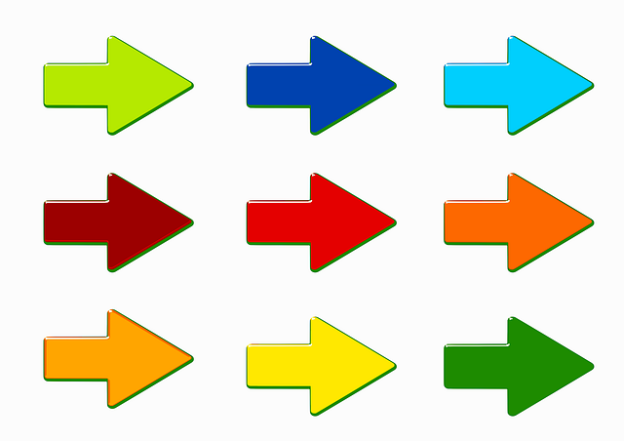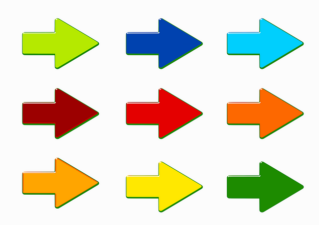Bild von Felix Müller auf Pixabay
Und als zweite Entscheidung dann ein schon etwas älterer Beschluss des OLG Frankfurt am Main. Es handelt sich um den OLG Frankfurt a. M., Beschl. v. 28.08.2023 – 3 ORbs 165/23.
Das AG hatte den Betroffenen vom Vorwurf einer Geschwindigkeitsüberschreitung – Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften um 72 km/h auf der A 3, geandet mit einer Geldbuße von 600,- EUR sowie einem Fahrverbot von drei Monaten – frei gesprochen.
Begründung: Die vor der Messstelle angebrachten Beschilderung bei km 151.250 verstoße gegen den Sicherbarkeitsgrundsatz, so dass sie als unwirksam zu betrachten sei. Insoweit hat das Amtsgericht folgende tatsächliche Feststellungen getroffen:
„Bis zur Messstelle bei km 151.990 hatte der Betroffene auf der A 3 folgende Verkehrszeichen zu passieren:
– Km 150,100 : Verkehrszeichen 274 mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h und ein sich unmittelbar darunter befindliches Zusatzzeichen im Sinne des § 39 Abs. 3 StVO (weißer Grund, schwarzer Rand, schwarze Schrift mit der Zeitangabe 22 bis 6 h, 1040-30 VZKat)
– Bei Km 151,200: an jeweils zwei Masten (links und rechts neben den drei Fahrspuren der Autobahn angebracht) senkrecht über-/untereinander zwei Verkehrszeichen (274) mit jeweils einem Zusatzeichen i.S.d. § 39 Abs. 3 StVO wie folgt angebracht:
— Ganz oben ist das Verkehrszeichen 274, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit für alle drei Fahrspuren auf 120 km/h begrenzt. Darunter ein sich auf dieses Verkehrszeichen beziehendes Zusatzzeichen (weißer Grund, schwarzer Rand, schwarze Schrift mit der Zeitangabe 6 bis 22 h, 1040-30 VZKat).
— Darunter Verkehrszeichen 274, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf allen drei Fahrspuren auf 100 km begrenzt, darunter erneut ein Zusatzzeichen, diesmal mit einer Zeitangabe 22-6 h (1040-30 VZKat).
Nach der Messstelle findet sich bei km 152.200 eine weitere Beschilderung mit dem Verkehrszeichen 274, welches die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf allen drei Fahrspuren auf 120 km/h begrenzt. Darunter befindet sich das Verkehrszeichen 278, welches die Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h aufhebt mit dem darunter befindlichen Zusatzzeichen Zeitangabe 22-6 h (1040-30 VZKat).“
Das AG sieht diese auf einem Autobahnabschnitt von ca. 2.1 km mehrfach angeordneten unterschiedlichen Geschwindigkeitsbegrenzungen als irreführend und mit einem „raschen und beiläufigen Blick“ nicht mehr als erfassbar an. Überdies ist es der Auffassung, dass diese Form der Beschilderung nicht mehr mit den allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung (VwV-StVO) vereinbar ist.
Dagegen die Rechtsbeschwerde der GStA, die u.a. Folgendes ausgeführt hat:
„Die Generalstaatsanwaltschaft hat hierzu folgendes ausgeführt:
„Ziffer 11 a) der VwV-StVO zu §§ 39 bis 43 StVO regelt, dass Häufungen von Verkehrszeichen zu vermeiden sind, weil die Bedeutung von Verkehrszeichen bei durchschnittlicher Aufmerksamkeit zweifelsfrei erfassbar sein muss. Am gleichen Pfosten oder sonst unmittelbar über- oder nebeneinander dürfen nicht mehr als drei Verkehrszeichen angebracht werden; bei Verkehrszeichen für den ruhenden Verkehr kann bei besonderem Bedarf abgewichen werden.
Auch Zusatzzeichen sind gemäß § 39 Abs. 3 Satz 1 StVO Verkehrszeichen. Die Häufung bei der Verwendung von Verkehrs- und Zusatzzeichen ist bereits durch § 39 Abs. 3 S. StVO vorgegeben, wonach Zusatzschilder immer direkt unter dem Verkehrsschild, das sie betreffen, anzubringen sind. Für Zusatzzeichen wird Ziffer 11 a) der Verwaltungsvorschrift durch Ziffer 16 der VwV-StVO zu §§ 39 bis 43 StVO zudem dahingehend konkretisiert, dass mehr als zwei Zusatzzeichen an einem Pfosten, auch zu verschiedenen Verkehrszeichen, nicht angebracht werden sollten und die Zuordnung der Zusatzzeichen zu den Verkehrszeichen eindeutig erkennbar sein muss. Damit geht auch der Verordnungsgeber davon aus, dass jedenfalls mindestens zwei Verkehrszeichen mit Jeweils zwei Zusatzzeichen versehen werden können. Dass Zusatzzeichcn nicht vollständig mit Verkehrszeichen gleichzusetzen sind, folgt auch aus Sinn und Zweck des Sichtbarkeitsgrundsatzes. Die Anforderungen an einen Kraftfahrer bei der Wahrnehmung von Schildern, die einen einheitlichen Regelungsgehalt haben, und darum handelt es sich grundsätzlich bei Verkehrszeichen in Verbindung mit Zusatzzeichen, sind schon wesentlich geringer, als bei Verkehrszeichen mit völlig unterschiedlichem Regelungsgehalt. Bei den hier zu beurteilenden zwei Geschwindigkeitsbeschränkungen mit jeweils einem konstitutiven Zusatzzeichen handelt es sich um eine einheitliche, wenn auch etwas komplexere Regelung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit, die anders gar nicht möglich war und nicht gegen die einschlägigen Vorgaben verstieß. Bei den durch Verwaltungsvorschrift getroffenen Vorgaben handelt es sich zwar nicht um Rechtsvorschriften, diese binden aber grundsätzlich die nachgeordneten Behörden und stellen für die gerichtliche Entscheidung eine Auslegungshilfe dar (BVerwG, Urteil vom 13.03.2008, 3 C 18/07).
Inwieweit den Anforderungen des Sichtbarkeitsgrundsatzes genügt wurde, ist letztlich von den konkreten Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängig (BVerwG, Urteil vom 06.04.2016, 3 C 10/15; OLG Frankfurt am Main, Beschluss vom 18.11.2021, 2 Ss OWi 646/21). Hier ließ die konkret angestrebte Verkehrsregelung, nämlich unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen für unterschiedliche Tageszeiten, keine andere Beschilderungsmöglichkeit zu. Dies erkennt auch das Amtsgericht, das argumentiert, zwar sei die an der Messstelle geltende Beschilderung „für sich alleine genommen noch vereinbar mit dem Grundsatz der Sichtbarkeit“ (UA S. 3), so dass es sich nicht um eine unnötige Häufung von Verkehrsschildern an einem einzelnen Mast, sondern eine solche bezogen auf den gegenständlichen Streckenabschnitt handele (UA S. 6). Es bestehe nämlich für den Verkehrsteilnehmer nicht die Möglichkeit, die Bedeutung der Verkehrszeichen in der aufeinanderfolgenden Reihenfolge zu erfassen, diese führten vielmehr zu „Verwirrung“ (UA S. 6).
Diese Argumentation ist nicht haltbar. Denn die angebliche Häufung von Verkehrszeichen sieht das Amtsgericht darin, dass ca. 1.1 km vor der hier maßgeblichen Geschwindigkeitsbegrenzung bereits eine Geschwindigkeitsbeschränkung (nur) für die Nachtzeit erfolgt war und etwa einen weiteren Kilometer nach der hier geltenden Anordnung weitere Regelungen erfolgten (UA S. 3, 4, 6). Hierbei verkennt das Amtsgericht, dass der Betroffene an der Messstelle von der späteren Beschilderung gar nicht verwirrt gewesen sein konnte, weil er sie zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wahrgenommen hatte. Die spätere Beschilderung ist damit für den hier zu beurteilenden Sachverhalt völlig unbeachtlich. Für den Betroffenen gab es lediglich die erste Beschränkung auf 120 km/h für die Nachtzeit und sodann die der [xxx]Messung zugrundeliegende Beschränkung mit unterschiedlichen Höchstgeschwindigkeiten für die Tag- und die Nachtzeit.
Auch wenn 1.1 km zuvor lediglich eine Beschränkung für die Nachtzeit erfolgt war, tagsüber also keine Geschwindigkeitsbegrenzung galt, hatte der Betroffene jedenfalls ab km 151.250 Anlass, seine gefahrene Geschwindigkeit zu reduzieren, weil ihm auch bei einem beiläufigen Blick erkennbar war, dass nun eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h galt. Unter Zugrundelegung der Argumentation des Amtsgerichts könnte sich ein Verkehrsteilnehmer ansonsten jedes Mal, wenn nach einer Strecke ohne Geschwindigkeitsbeschränkung eine neue Anordnung erfolgt, auf den angeblichen „Gewöhnungseffekt“ (UA S. 4) berufen und behaupten, es sei ihm nicht gelungen, die neue „Information hinreichend schnell und zutreffend zu verarbeiten“ (UA S. 4). Hier lässt das Amtsgericht vor allem außer Acht, dass ein Kraftfahrer so zu fahren hat, dass er Verkehrszeichen jederzeit wahrnehmen und beachten kann, was auch und insbesondere für geschwindigkeitsbeschränkende Verkehrszeichen, bei denen es sich auf einer Autobahn weder um seltene noch überraschende Anordnungen handelt, gilt. Da sich die Messstelle erst 700 m nach der Anordnung befand, hatte der Betroffene auch ausreichend Zeit, seine Geschwindigkeit zu reduzieren, zumal eine Geschwindigkeitsbegrenzung von dem entsprechenden Schild an zu beachten ist (vgl. OLG Frankfurt, Beschluss vom 03.01.2001, 2 Ws (B) 582/00 OWiG, juris).
Ob und welche Angaben zur Sache der Betroffene in der Hauptverhandlung gemacht hat, ergibt sich aus den Urteilsgründen, die ausschließlich auf die vermeintliche Unwirksamkeit der getroffenen Anordnung abstellen, nicht. Jedenfalls kann sich der Betroffene nicht darauf berufen, den Sinngehalt dieser Schilder überhaupt nicht erfasst zu haben. Selbst, wenn die konkrete Zeitregelung für ihn – möglicherweise aufgrund der gefahrenen Geschwindigkeit – nicht unmittelbar erkennbar gewesen sein sollte, musste er doch wahrgenommen haben, dass die Schilder Höchstgeschwindigkeiten von 100 bzw. 120 km/h für verschiedene Zeiten anordneten und deshalb eine Verringerung der gefahrenen Geschwindigkeit von 192 km/h jedenfalls auf 120 km/h erforderten.
Dass das Messprotokoll nicht sämtliche an der Messstelle gültigen Verkehrszeichen aufführt (UA S. 2 f.), beeinträchtigt weder die Gültigkeit der Anordnung noch die Richtigkeit der Messung. Denn es wurde der Messung und dem Protokoll jedenfalls die zum Tatzeitpunkt gültige Geschwindigkeitsbegrenzung zugrunde gelegt, bei der es sich im Übrigen auch um die dem Betroffenen günstigere handelt.
Soweit der erkennende Richter auf die seiner Meinung nach fehlende Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit der Anordnungen in ihrer Gesamtheit bezogen auf den Streckenabschnitt von km 150.100 bis km 152.200 abstellt (UA S. 6), verkennt es seinen Prüfungsmaßstab und ist diese Argumentation unbeachtlich.“
Diesen ausführlichen und überzeugenden Ausführungen schließt sich der Senat vollumfänglich an. Ergänzend merkt er lediglich an, dass auch die weitere Argumentation des Amtsgerichts, die vermeintliche Häufung der von der Messstelle km 151.990 erfassten Geschwindigkeitsverstöße sei auf eine „Irreführung“ der Verkehrsteilnehmer durch eine „nicht ordnungsgemäße“ Beschilderung zurückzuführen, die Entscheidung nicht trägt. Hierbei handelt es sich um eine nicht tatsachenbelegte Vermutung, kann der Anstieg von Geschwindigkeitsverstößen auch gänzlich andere Ursachen haben. Ausweislich der für den Senat durch die wirksame Bezugnahme auf das Lichtbild Bl. 9 zugänglichen Inaugenscheinnahme des maßgeblichen Streckenabschnitts mit Beschilderung handelt es sich um eine gerade übersichtliche Passage, bei der die deutlich sichtbaren, nach Tages-/Nachtzeit gestaffelten und in ihrer Bedeutung ohne weiteres erfassbaren Geschwindigkeitsbegrenzungen von Autofahrern erfahrungsgemäß auch mangels Regelakzeptanz schlichtweg um des eigenen schnellen Fortkommens ignoriert werden können.“