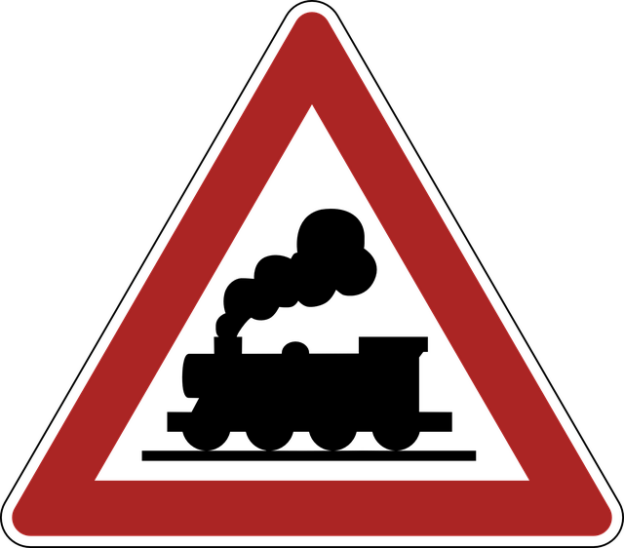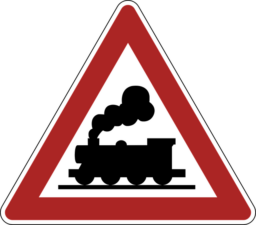Vor dem morgien Gebührenfreitag heute dann StGB-Entscheidungen, und zwar zu Nebenrechtsfolge,
Hier zunächst etwas vom BGH zum Berufsverbot (§ 70 StGB), und zwar der BGH, Beschl. v. 26.03.2024 – 4 StR 416/23. Das LG hat den Angeklagten wegen sexuellen Missbrauchs in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch unter Ausnutzung eines Behandlungsverhältnisses zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Ferner hat es ihm für die Dauer von fünf Jahren untersagt, den Beruf des Arztes auszuüben. Dagegen die Revision, die wegen des Berufsverbots Erfolg hatte:
„1. Das Landgericht hat folgende Feststellungen getroffen:
Der Angeklagte ist von Beruf Arzt. Er absolvierte erfolgreich zwei Facharztausbildungen. Nachdem er seit 2006 – unter anderem als leitender Oberarzt – in verschiedenen Krankenhäusern tätig gewesen war, gründete er im Jahr 2018 eine eigene orthopädische Praxis. Am 16. Oktober 2020 suchte die unter Depressionen leidende Nebenklägerin wegen anhaltender starker Rückenschmerzen absprachegemäß die Praxis des Angeklagten auf und wurde zur manuellen Therapie in ein dafür vorgesehenes Behandlungszimmer geführt. Nach Schmerzmittelgabe mittels Injektion massierte der Angeklagte die auf der Seite liegende und ihm den Rücken zuwendende Nebenklägerin am Gesäß, nachdem er hierzu ihre Hose ein Stück heruntergezogen hatte. Anschließend verließ er den Raum. Nach einer Weile kehrte er zurück, zog die in unveränderter Position liegende Nebenklägerin an ihrer Hüfte zu sich an den Rand der Liege und trat so dicht an sie heran, dass die Nebenklägerin – hiervon völlig überrascht – seinen erigierten Penis spürte. Nach einem erneuten kurzzeitigen Verlassen des Behandlungszimmers zog der Angeklagte die Nebenklägerin, die in der Zwischenzeit versucht hatte, von der Kante der Liege abzurücken, wieder zu sich heran. Er öffnete seine Hose und drückte seinen erigierten Penis zwischen die Pobacken der perplexen Nebenklägerin. Anschließend schob er ihren Slip zur Seite und begann Stoßbewegungen zu vollziehen. Sodann zog der Angeklagte ihr Bein hoch und rieb seinen Penis bis zur Ejakulation zwischen den Gesäßhälften der Nebenklägerin, die das Geschehen „wie paralysiert“ weitestgehend wort- und regungslos über sich ergehen ließ. Der Angeklagte setzte sich dabei über den entgegenstehenden Willen der Nebenklägerin hinweg und hatte zudem erkannt, dass diese wegen der „Überrumpelung“ in der Behandlungssituation zu keiner Abwehr in der Lage war.
2. Der Maßregelausspruch hat keinen Bestand, weil das Landgericht bei der Gefährlichkeitsprognose im Sinne des § 70 Abs. 1 StGB nicht alle maßgeblichen Gesichtspunkte in die gebotene Gesamtwürdigung eingestellt hat.
a) Das Berufsverbot ist ein schwerwiegender Eingriff, mit dem die Allgemeinheit, sei es auch nur ein bestimmter Personenkreis, vor weiterer Gefährdung geschützt werden soll. Es darf nur dann verhängt werden, wenn die Gefahr besteht, dass der Täter auch in Zukunft den Beruf, dessen Ausübung ihm verboten werden soll, zur Verübung erheblicher Straftaten missbrauchen wird. Voraussetzung hierfür ist, dass eine – auf den Zeitpunkt der Urteilsverkündung abgestellte – Gesamtwürdigung des Täters und seiner Tat(en) das Tatgericht zu der Überzeugung führt, dass die Wahrscheinlichkeit künftiger ähnlicher erheblicher Rechtsverletzungen durch den Täter besteht (vgl. BGH, Beschluss vom 22. Juni 2023 – 2 StR 144/23 Rn. 5; Beschluss vom 9. Oktober 2018 – 1 StR 418/18 Rn. 8, jew. mwN). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass an die Annahme einer weiteren Gefährlichkeit im Sinne des § 70 Abs. 1 Satz 1 StGB ganz besonders strenge Anforderungen zu stellen sind, wenn der Täter erstmalig wegen einer Anlasstat straffällig wird; insbesondere ist zu prüfen, ob bereits die Verurteilung zur Strafe den Täter von weiteren Taten abhalten wird (vgl. BGH, Urteil vom 25. April 2013 – 4 StR 296/12 Rn. 7; Beschluss vom 12. September 1994 – 5 StR 487/94, NStZ 1995, 124).
b) Zur Gefährlichkeitsprognose hat das Landgericht ausgeführt, dass es auch künftig zu vergleichbaren Kontakten mit psychisch labilen Patientinnen kommen werde, bei denen das Risiko einer Aufdeckung und Aburteilung etwaiger Sexualstraftaten reduziert erscheinen könnte. Im Lichte der festgestellten Tatmodalitäten und der Persönlichkeit des Angeklagten lägen daher zum Zeitpunkt der Urteilsverkündung ähnlich erhebliche Rechtsgutsverletzungen in der Zukunft nahe.
Damit hat das Landgericht maßgebliche Gesichtspunkte unberücksichtigt gelassen. So hat es nicht bedacht, dass der Angeklagte zur Zeit der Begehung der hier abgeurteilten Tat strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten war. Das Landgericht lässt weiter unerörtert, dass gegen ihn mit dem angefochtenen Urteil eine empfindliche Freiheitsstrafe verhängt worden ist und es daher naheliegt, dass die Verurteilung und die (bevorstehende) Vollstreckung den Angeklagten bereits nachhaltig beeindrucken. Auch hat es insoweit nicht in den Blick genommen, wie der 50 Jahre alte und seit 2006 als Arzt tätige Angeklagte seinen Beruf im Übrigen ausgeübt hat (vgl. BGH, Beschluss vom 9. Oktober 2018 – 1 StR 418/18 Rn. 8).“