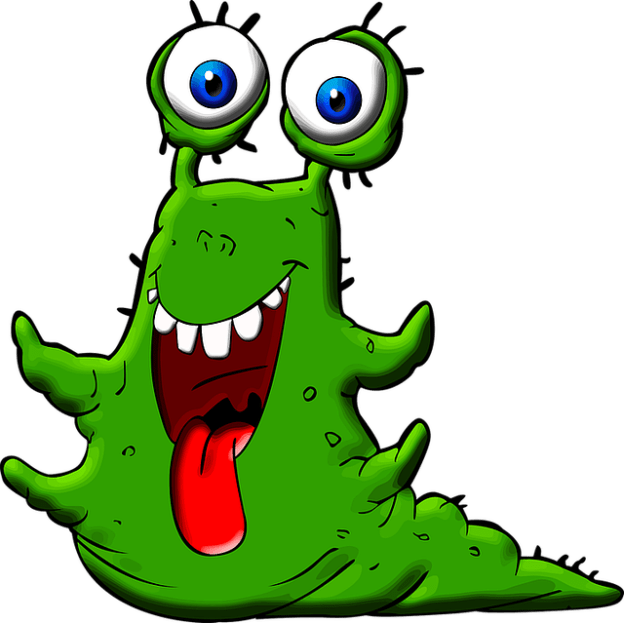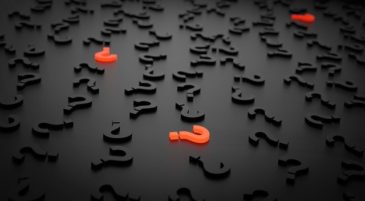Und dann als dritte Entscheidung der BayObLG, Beschl. v. 24.04.2024 – 201 ObOWI 339/24 – zur Begründung der Verfahrensrüge zur Beanstandung rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung bei Verwerfungsurteil-
Das AG hat den Einspruch des Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid wegen Geschwindigkeitsverbot mit einem Fahrverbot von einem Monat mit Urteil vom 24.03.2021 gem. § 74 Abs. 2 OWiG verworfen. Das Urteil wurde dem Verteidiger am 26.03.2021 zugestellt. Das Hauptverhandlungsprotokoll wurde am 29.03.2021 fertiggestellt. Gegen das Urteil hat der Betroffene am 29.03.2021 Rechtsbeschwerde eingelegt, mit der er die Verletzung „formellen und materiellen Rechts“ rügte. Er hat mit Verteidigerschriftsatz vom 13.10.2023 beantragt, eingegangen bei Gericht am 21.11.2023, das Verfahren wegen einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung einzustellen. Am 27.11.2023 wurde dem Verteidiger das Urteil nochmals zugestellt. Eine ergänzende Rechtsbeschwerdebegründung ist nicht erfolgt. Die Rechtsbeschwerde wurde vom BayObLG als unbegründet verworfen:
„b) Das vom Betroffenen geltend gemachte Verfahrenshindernis der rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung bedurfte vorliegend auch nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils der Erhebung einer formalen Rüge. Eine solche wurde jedoch nicht in zulässiger Weise ausgeführt (§ 344 Abs. 2 Satz 2 StPO, § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG).
aa) Will der Beschwerdeführer die Verletzung des Beschleunigungsgebotes geltend machen, erfordert dies grundsätzlich die Erhebung einer Verfahrensrüge (st.Rspr., vgl. u. a. BGH, Beschl. v. 20.06.2007 – 2 StR 493/06 bei juris Rn. 9; zuletzt BGH, Beschl. v. 15.03.2022 – 4 StR 202/21 bei juris Rn. 16, jew. m.w.N.). Ein Ausnahmefall, für den die höchstrichterliche Rechtsprechung im Revisionsverfahren angenommen hat, das Rechtsmittelgericht habe wegen eines Erörterungsmangels auf die Sachrüge hin einzugreifen, liegt hier schon deshalb nicht vor, weil die Verzögerung erst nach Urteilserlass eingetreten ist und sich nicht aus den Urteilsgründen ergibt.
Allerdings kann für Verzögerungen nach Urteilserlass die bloße Erhebung der Sachrüge ausreichend sein, wenn der Betroffene die Gesetzesverletzung deshalb nicht form- und fristgerecht rügen konnte, weil die Verzögerung erst nach Ablauf der Rechtsbeschwerdebegründungsfrist eingetreten ist und deshalb vom Beschwerdeführer nicht (mehr) mit der Verfahrensrüge geltend gemacht werden konnte (BGH NStZ 2001, 52; BGH, Beschl. v. 20.06.2007 a.a.O. Rn. 10). Ein solcher Fall liegt jedoch nicht vor, da die Frist zu Einlegung und Begründung der Rechtsbeschwerde erst mit Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe begann (§ 345 Abs. 1 Satz 1 StPO, § 79 Abs. 3 Satz 1, Abs. 4 Satz 1 OWiG). Die am 26.03.2021 erfolgte Zustellung des Urteils konnte die Frist zur Einlegung und Begründung der Rechtsbeschwerde nicht in Lauf setzen, weil nach § 273 Abs. 4 StPO das Urteil nicht zugestellt werden durfte, bevor das Protokoll fertiggestellt war. Der Verstoß hiergegen machte die Zustellung wirkungslos und setzte deshalb die genannten Fristen nicht in Lauf (st.Rspr., vgl. zuletzt zur Revisionsbegründungsfrist BGH, Beschl. v. 24.11.2020 – 5 StR 439/20 bei juris = NStZ-RR 2021, 57 = StraFo 2021, 164 = BeckRS 2020, 36921 m.w.N.). Der Betroffene war von daher nicht gehindert, zu den Verfahrenstatsachen vorzutragen, aus denen er das Vorliegen einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung herleiten will, zumal er vor der zweiten Zustellung Akteneinsicht hatte.
bb) Die Erhebung einer Verfahrensrüge war auch nicht deshalb entbehrlich, weil bei Vorliegen einer zulässigen Rechtsbeschwerde grundsätzlich (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt StPO 66. Aufl. Einl. Rn. 150 m.w.N.) das Vorliegen eines Verfahrenshindernisses von Amts wegen zu prüfen ist (Meyer-Goßner/Schmitt a.a.O. und Art. 6 EMRK Rn. 9g; Meyer-Goßner NStZ 2003, 173; a.A. Wohlers JR 2005, 189; offengelassen: BGH, Beschl. v. 10.09.2003 – 5 StR 330/03 bei juris). Dies gilt jedenfalls in den Fällen, in denen der Tatrichter lediglich den Einspruch des Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid gemäß § 74 Abs. 2 OWiG verwirft.
(1) Aus rechtsstaatlichen Gründen kann die Verfahrenseinstellung wegen überlanger Verfahrensdauer dann unabweisbar sein, wenn sie auf einer außergewöhnlichen, vom Betroffenen nicht zu vertretenden und auf Versäumnisse der Justiz zurückzuführenden Verfahrensverzögerung beruht, die den Betroffenen im Lichte der Gesamtdauer des Verfahrens unter Abwägung der Gesamtumstände des Einzelfalls, namentlich des Tatvorwurfs, des Umfangs und der Schwierigkeit des Verfahrensgegenstandes, des festgestellten oder voraussichtlich feststellbaren Schuldumfangs sowie möglicher Belastungen durch das Verfahren, in unverhältnismäßiger Weise belastet und der Verzögerung im Rahmen der Sachentscheidung nicht mehr hinreichend Rechnung getragen werden kann (vgl. BGHSt 35, 137 ff.; BGHSt 46, 159 ff.).
(2) Die Frage, ob und in welchem Umfang eine Kompensation bei Vorliegen einer Verfahrensverzögerung erforderlich ist, ist somit das Ergebnis einer Abwägung der Gesamtumstände des Einzelfalls. Ob eine Verfahrensverzögerung unerheblich ist, ob die bloße Feststellung der Verfahrensverzögerung dem Betroffenen ausreichende Kompensation verschafft (vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 02.10.2018 – 6 Kart 6/17 [OWi] bei juris Rn. 1269; OLG Stuttgart, Beschl. v.04.06.2018 – 3 Rb 26 Ss 786/17 bei juris), ob ein „Normalfall“ überlanger Verfahrensdauer vorliegt, der durch die Anrechnung eines Teils der verhängten Geldbuße oder des Fahrverbots kompensiert werden kann (vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 11.02.2021 – 4 RBs 13/21 bei juris; beim Verwerfungsurteil verneinend: OLG Rostock, Beschl. v. 27.01.2016 – 21 Ss OWi 2/16 [B] bei juris Rn. 11) oder ob sich der Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot als derartig schwer und außergewöhnlich darstellt, dass ihm nur durch die Einstellung des gesamten Verfahrens Rechnung getragen werden kann, kann nicht ohne Kenntnis der verhängten Sanktion und der damit verbundenen Belastungen für den Betroffenen beantwortet werden, wobei sich letztere oftmals der genauen Kenntnis der Justiz entziehen.
In einem Fall, in dem der Tatrichter lediglich den Einspruch des Betroffenen gegen den Bußgeldbescheid gemäß § 74 Abs. 2 OWiG verwirft, kommt hinzu, dass sich, anders als bei einem Urteil in der Sache, Tatunrecht und Verfahrensverzögerungen bis zum Erlass des Urteils schon nach der Natur der Entscheidung nicht aus den Urteilsgründen selbst ergeben, während der Betroffene hierzu unschwer Ausführungen machen kann. Eine rechtsstaatswidrige Verfahrensverzögerung von Amts wegen bei zulässiger Rechtsbeschwerde zu berücksichtigen, widerspräche somit der differenzierten geltenden rechtlichen Systematik, wonach der Betroffene gehalten ist, alle diesbezüglichen Umstände vorzutragen, es sei denn sie würden sich aus der Entscheidung selbst ergeben, die Entscheidung wäre lückenhaft oder die Umstände würden sich, weil sie erst nach Ablauf der Rechtsbeschwerdebegründungsfrist entstanden sind, der formgerechten Begründung entziehen.
cc) Die Rechtsbeschwerdeausführungen genügen nicht, um das Vorliegen der tatsächlichen Voraussetzungen einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung aufzuzeigen (§ 344 Abs. 2 Satz 2 StPO, § 79 Abs. 3 OWiG).
(1) Die Rechtsbeschwerde teilt zwar mit, dass mit Beschluss des Amtsgerichts München vom 27.04.2021 der Antrag des Betroffenen nach § 74 Abs. 4 OWiG auf Wiedereinsetzung in die versäumte Hauptverhandlung zurückgewiesen wurde. Sie verhält sich in diesem Zusammenhang aber nicht zu der Frage, wann dem Betroffenen der Beschluss zugestellt wurde, ob er dagegen Rechtsmittel eingelegt hatte und wann gegebenenfalls seitens des Rechtsmittelgerichts hierüber entschieden wurde. Ausführungen hierzu erweisen sich jedoch als notwendig, weil bis zur Rechtskraft des die Wiedereinsetzung versagenden Beschlusses das Rechtsbeschwerdeverfahren von Gesetzes wegen ruhte (§ 342 Abs. 2 Satz 2 StPO, § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG). Der Senat kann daher nicht prüfen, ob und in welchem Umfang die Notwendigkeit der Bearbeitung eines Rechtsmittels des Betroffenen mit dazu beigetragen hat, dass die Akten nicht dem Rechtsbeschwerdegericht vorgelegt wurden.
(2) Es fehlen auch sonst jegliche Darlegungen für den betreffenden Zeitraum vom 27.04.2021 bis 26.09.2023. Die Frage, ob und in welchem Umfang eine Verfahrensverzögerung eine Kompensation erforderlich macht und welcher Art diese gegebenenfalls sein muss, setzt, wie ausgeführt, eine wertende Betrachtung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls voraus. Maßstab ist der Umfang der staatlich zu verantwortenden Verzögerung, das Maß des Fehlverhaltens der Verfolgungsorgane und die daraus folgenden individuellen Belastungen für den Betroffenen (BGH, Urt. v. 13.03.2011 – 5 StR 411/11 bei juris Rn. 8; BGH, Urt. v. 23.10.2013 – 2 StR 392/13 bei juris Rn. 9). Der Senat kann jedoch, da Einzelheiten für den Grund der Verzögerung nicht genannt werden, nicht prüfen, ob und in welchem Umfang der Betroffene in ihm zurechenbarer Weise selbst zu der Verfahrensverzögerung beigetragen hat.
(3) Der vorliegende Fall weist zudem die Besonderheit auf, dass dem Kraftfahrtbundesamt nach dem Vorbringen des Betroffenen (fälschlicherweise) die Rechtskraft der Entscheidung vom 24.03.2021 mitgeteilt worden war. Nachdem es nicht der Lebenserfahrung entspricht, dass eine von der Vollstreckungsbehörde für rechtskräftig gehaltene Entscheidung nicht auch vollstreckt wird, liegt der Schluss nahe, dass der Betroffene seine Fahrerlaubnis in amtliche Verwahrung gegeben und die Geldbuße bezahlt hat, obwohl er damit rechnen musste, dass die zugrunde liegende Entscheidung noch gar nicht rechtskräftig war, nachdem er gegen sie Rechtsbeschwerde eingelegt hatte und eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts nicht ergangen war. Im Rahmen der Gesamtbetrachtung zu Notwendigkeit und Art der Kompensation, bei der auch die Folgen der Verfahrensverzögerung speziell für den Betroffenen und sein Umgang mit dieser von Bedeutung sind, hätte dieser Umstand nicht unberücksichtigt bleiben dürfen und es hätte hierzu von der Rechtsbeschwerde vorgetragen werden müssen.
dd) Ob im vorliegenden Fall dem Grunde nach Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Nachholung der nicht ordnungsgemäß ausgeführten Verfahrensrüge hätte in Betracht kommen können, braucht nicht entschieden zu werden. Eine solche ist auch nach Mitteilung der Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft München vom 20.03.2024, aus der hervorging, dass die Frist zur Begründung der Rechtsbeschwerde erst mit der am 27.11.2023 bewirkten Zustellung zu laufen begonnen hatte, und zur Geltendmachung einer rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung die Erhebung einer Verfahrensrüge erforderlich war, nicht nachgeholt worden.“