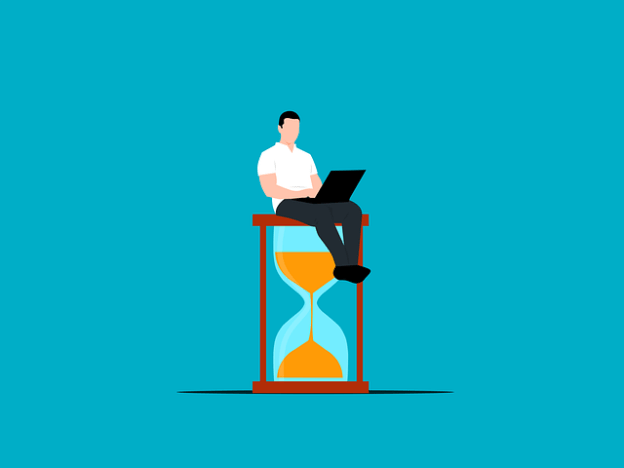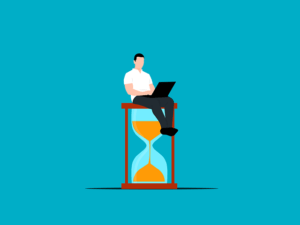Der Verteidiger hatte einen Pflichtverteidigerwechsel in der Revisionsinstanz beantragt. Das ist vom KG abgelehnt worden, u.a. wegen Versäumung der Frist des § 143a StPO. Wiedereinsetzung hat das KG dann auch nicht gewährt:
„5. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wegen Versäumung der Frist. zur Anbringung des Antrags auf Verteidigerwechsel für die Revisionsinstanz nach § 143a Abs. 3 Satz 1 StPO ist unzulässig.
a) Zur Entscheidung über das Wiedereinsetzungsgesuch war die Vorsitzende des Senates berufen. Gemäß § 46 Abs. 1 StPO ist bei Wiedereinsetzungsanträgen das Gericht, das bei rechtzeitiger Handlung zur ‚Entscheidung in der Sache berufen gewesen wäre, zuständig. Zwar ist der Antrag auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers für die Revisionsinstanz nach § 143a Abs. 3 Satz 2 StPO bei dem Gericht zu stellen, dessen Urteil angefochten wird. Die- Zuständigkeit für die Entscheidung über den Beiordnungsantrag liegt auch zunächst bei dem (Vorsitzenden des) Gericht(s), dessen Entscheidung angefochten wird (BGH, Beschluss vom 11. September 2019 2 StR 281/19 -, BeckRS 2019, 27180; OLG Rostock, NStZ-RR 2010, 342f.; BT-Drs. 19/13829, S. 49; Schmitt in Meyer-Goßner/ Schmitt, a.a.O. § 142 Rn. 16). Seit der Vorlage der Akten durch. die Generalstaatsanwaltschaft verbunden mit dem zugleich gestellten Antrag nach § 349 Abs. 2 StPO ist das Verfahren indes beim erkennenden Senat anhängig. Mit Anhängigkeit der Sache ist die Zuständigkeit für die Entscheidung über den unerledigten Antrag und damit auch die Zuständigkeit für die Entscheidung über ein entsprechendes Wiedereinsetzungsgesuch gemäß § 347 Abs. 2 StPO auf die Vorsitzende des Senates übergegangen (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Februar 2023 – 3 StR 450/22 -, juris; OLG Rostock, a.a.O.; Schmitt in Meyer-Goßner/ Schmitt, a.a.O. § 142 Rn. 16).
Vor dem Hintergrund, dass Rechtsanwalt Dr. pp. seiner Funktion als Wahlverteidiger die vom damaligen. Pflichtverteidiger form- und fristgemäß eingelegte Berufung innerhalb der Revisionsbegründungsfrist auf das Rechtsmittel der Sprungrevision umgestellt und diese auch innerhalb der Frist des § 345 Abs. 1 StPO begründet hat, entsteht dem Angeklagten durch die vom Amtsgericht Tiergarten verabsäumte Entscheidung. über den Beiordnungsantrag (anders als in dem der Entscheidung. des BGH, Beschluss vom 11. September 2019 – 2 StR 281/19 -, BeckRS 2019, 27180 zugrunde liegenden Verfahren) kein Nachteil, weshalb eine Rückgabe an das Tatgericht zur Nachholung der Beiordnungsentscheidung nicht in Betracht kam.
b) Allerdings ist der Wiedereinsetzungsantrag nicht zulässig.
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist zu gewähren, wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine Frist einzuhalten (§ 44 Satz 1 StPO). Vorzutragen und glaubhaft zu machen ist dabei ein Sachverhalt, der ein der Wiedereinsetzung entgegenstehendes Verschulden ausschließt (Schmitt in Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 45 Rn. 5a).
Hieran fehlt es:
Der Angeklagte hat bereits nicht dargetan, dass er an der Einhaltung der versäumten Frist gehindert war. Die Frist von einer Woche zur Beantragung eines Verteidiger-wechsels für die Revisionsinstanz hat- gesetzlich vorgesehen parallel mit dem Beginn der Revisionsbegründungsfrist – gemäß §§ 345 Abs. 1 Satz‘ 3 StPO mit der am Montag, dem 24. April 2023 erfolgten Zustellung des Urteils an den damaligen Pflichtverteidiger zu laufen begonnen und endete – da Montag, der 1. Mai 2023 ein allgemeiner Feiertag war – gemäß § 43 Abs. 1 und Abs. 2 StPO mit Ablauf des 2. Mai 2023. Sein zeitgleich mit Umstellung auf das Rechtmittel der Revision am 23. Mai 2023 gestellter Antrag nach § 143a Abs. 3 Satz 1 StPO ist daher verspätet. Weshalb der Angeklagte an einem früheren Antrag auf Verteidigerwechsel für die Revisionsinstanz gehindert war, ist weder vorgetragen noch sonst ersichtlich.
Der Umstand, dass während des Laufs der Wochenfrist nach § 143a Abs. 3 Satz 1 StPO die Revision – wie hier bei der erst später durch Umstellung erfolgten Einlegung der Sprungrevision nach § 335 StPO – noch gar nicht eingelegt war, hindert weder deren gesetzlich geregelten Beginn noch deren Ablauf.
Eine von Amts wegen zu gewährende Wiedereinsetzung in den vorigen Stand bedingt die hier vorliegende Konstellation ebenfalls nicht. Die in § 143a Abs. 3 StPO ermöglichte Auswechslung des Pflichtverteidigers ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Revisionsinstanz soll – unter anderem – der Tatsache Rechnung tragen, dass es für die Revisionsbegründung und die weitere Vertretung des -Angeklagten in der Revision häufig spezieller, vertiefter Rechtskenntnisse und Erfahrungen im Revisionsrecht bedarf (BT-Drs. 19/13829, S. 49). Sinn und Zweck der gesetzlichen Fristvorgabe, den Antrag auf Auswechslung des Verteidigers spätestens eine Woche nach Beginn der Revisionsbegründungsfrist stellen, ist es, dem Angeklagten bzw. seinem bisherigen Verteidiger, der vorsorglich Rechtsmittel eingelegt hat, zu ermöglichen, erst nach Prüfung der Urteilsbegründung und des Protokolls endgültig über die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit des Wechsels zu einem anderen Verteidiger, insbesondere einem Revisionsspezialisten, zu entscheiden (BT-Drs. 19/13829, S. 50). Dass sich der Angeklagte und sein damaliger Pflichtverteidiger im vorliegenden Fall in der dem Gesetzgeber bei Schaffung des erleichterten Verteidigerwechsels vorschwebenden oder einer vergleichbaren Entscheidungssituation befunden hätten, ist nicht ersichtlich. Ausweislich seines Meldeschriftsatzes vom 22. März 2023 war Rechtsanwalt Dr. pp. – als Wahlverteidiger – bereits mandatiert, als die Revisionsbegründungsfrist noch nicht einmal begonnen hatte.
In seiner Funktion als Wahlverteidiger hat Rechtsanwalt Dr. pp. vor der fristgemäß erfolgten Umstellung auf und Begründung der Revision die ihm mit Verfügung der Abteilungsrichterin vom 19. April 2023 gewährte Möglichkeit der Akteneinsicht wahrgenommen. Spätestens hierdurch hatte er daher die umfassende Möglichkeit, sich – und den Angeklagten – über die Sach-, Rechts-, und Fristenlage im Verfahren zu informieren. Dabei lassen seine Ausführungen vom 23. Mai 2023 auch erkennen, dass (aber nicht seit wann) er Kenntnis vom Zeitpunkt der Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe – und damit vom Lauf der Revisionsbegründungsfrist sowie der Frist des § 143a Abs. 3 Satz 1 StPO – hatte.
Soweit die vorliegende prozessuale Konstellation der späteren Umstellung auf eine Sprungrevision bedingt, dass bei Ablauf der Antragsfrist des § 143a Abs. 3 Satz 1 StPO die Revision möglicherweise noch nicht eingelegt ist, entbindet dies den Angeklagten nicht davon, dies im Einzelfall vorzutragen und glaubhaft zu machen, weshalb er ohne Verschulden an der Stellung des Antrags nach § 143a Abs. 3 StPO – gegebenenfalls in Verbindung mit der Umstellung des Rechtsmittels auf die Sprungrevision bei späterer Begründung – gehindert war und wann dieses Hindernis weggefallen ist.
2. Der Antrag des Angeklagten, ihm seinen Wahlverteidiger Rechtsanwalt Dr. pp. als Pflichtverteidiger zu bestellen, war abzulehnen, da die gesetzlichen Voraussetzungen nicht gegeben sind.
a) Zwar ist die Auswechslung des Pflichtverteidigers ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes für das Revisionsverfahren nach § 143a Abs. 3 StPO möglich. Allerdings hat der Angeklagte – wie oben unter III. 1. b) ausgeführt – die mit Antragstellung am 23. Mai 2023 einzuhaltende Wochenfrist nicht gewahrt.
b) Ebenso wenig liegen die Voraussetzungen für einen Pflichtverteidigerwechsel nach § 143a Abs. 2 Satz 1 StPO vor, wobei hier allein die Nr. 3 in Betracht zu ziehen ist. Für eine endgültige Zerstörung des Vertrauensverhältnisses zwischen v der Angeklagten und seinem bisherigen Pflichtverteidiger oder dafür, dass eine angemessene Verteidigung des Angeklagten durch den bisherigen Pflichtverteidiger nicht gewährleistet wäre, ist nichts vorgetragen.
c) § 143a StPO schließt allerdings die Möglichkeit eines konsensualen Verteidigerwechsels nicht aus. Dieser setzt voraus, dass, sowohl der Angeklagte als auch beide Verteidiger mit dem Wechsel einverstanden sind, keine Verfahrens-verzögerung eintritt und dass keine Mehrkosten entstehen (BT-Drs. 19/13829, S. 47; Schmitt in Meyer-Goßner/Schmitt, a.a.O., § 143a Rn. 31). Vorliegend hat sich zwar der damalige Pflichtverteidiger mit der Aufhebung seiner Beiordnung einverstanden erklärt.
Allerdings liegt weder vom damaligen Pflichtverteidiger noch von Rechtsanwalt Dr. pp. eine Erklärung über einen zur Vermeidung von Mehrkosten erforderlichen Gebührenverzicht vor. Jedenfalls ist für beide Rechtsanwälte die Grundgebühr nach Nr. 4100 W-RVG entstanden, die der bisherige Pflichtverteidiger mit Kostenfestsetzungsantrag vom 21. April 2023 geltend gemacht hat und die mit Verfügung 12. Mai 2023 an ihn ausgezahlt wurde.
Mangels einer Verzichtserklärung Rechtsanwalt Dr. pp. hätte seine Bestellung zum Pflichtverteidiger zur Folge, dass die Landeskasse .die Grundgebühr doppelt erstatten müsste.
d) Auch liegt beim gegenwärtigen Stand des Revisionsverfahrens – anderes mag dich bei der erneuten Verhandlung vor dem Amtsgericht Tiergarten ergeben – kein Fall der notwendigen Verteidigung nach § 140 Abs. 1 oder Abs. 2 StPO vor.“