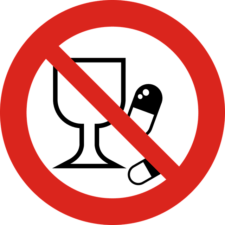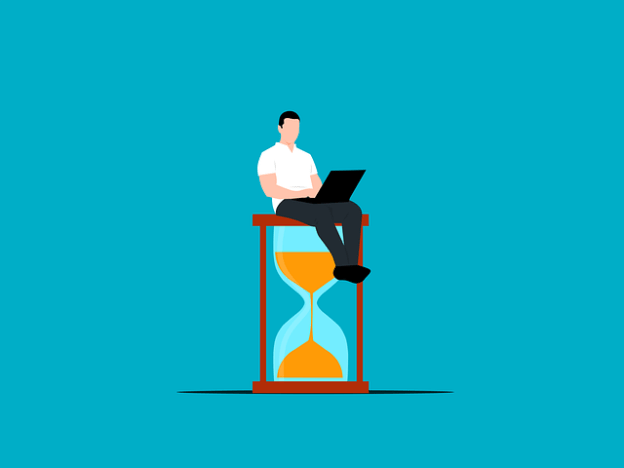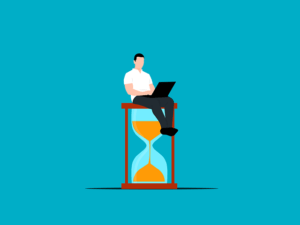Und heute dann einige vllstreckungsrechtliche OLG-Entscheidung.
Ich beginne mit dem OLG Hamm, Beschl. v. 25.05.2023 – III 2 Ws 67/23 – zur Frage der Zulässigkeit einer sog. Abstinenzweisung bei einem Suchtkranken. Das OLG sagt – wie die h.M. – unter Hinweis auf die Rechtsprechung des BVerfG:
„Nach § 68b Abs. 1 S. 1 Nr. 10 StGB kann das Gericht einer verurteilte Person für die Dauer der Führungsaufsicht oder für eine kürzere Zeit anweisen, keine alkoholischen Getränke oder andere berauschende Mittel zu sich zu nehmen, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen Gründe für die Annahme bestehen, dass der Konsum solcher Mittel zur Begehung weiterer Straftaten beitragen wird, und sich Alkohol- oder Suchtmittelkontrollen zu unterziehen, die nicht mit einem körperlichen Eingriff verbunden sind. Eine solche Abstinenzweisung kommt vor allem für im Vollzug erfolgreich behandelte rauschmittelabhängige Probanden in Betracht. Problematisch ist ein Konsumverbot hingegen bei Personen, die eine langjährige, nicht (erfolgreich) therapierte Suchtmittelabhängigkeit aufweisen. Voraussetzung ist zunächst, dass bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Rauschmittelkonsum zur Gefahr weiterer Straftaten beitragen könnte. Maßgeblich ist nicht das Rückfallrisiko an sich, sondern die Wahrscheinlichkeit eines „Beitrags“ zu strafbaren Handlungen, zum Beispiel auch die Gefahr von Beschaffungskriminalität (vgl. Fischer, StGB, 70. Aufl., § 68b Rn. 14). Demgemäß muss eine solche Weisung geeignet sein, den mit ihr angestrebten Zweck zu erreichen, wobei bereits die Möglichkeit der Zweckerreichung genügt. Bei einer Abstinenzweisung muss also die Möglichkeit bestehen, dass Straftaten unterbleiben, die im Fall weiteren Suchtmittelkonsums zu erwarten wären. Ungeeignet wäre eine Abstinenzweisung hingegen, wenn eine Verminderung des Risikos der Begehung weiterer Straftaten aufgrund dieser Weisung ausgeschlossen werden kann (BVerfG, Beschluss vom 30.03.2016 – 2 BvR 496/12, NJW 2016, 2170, 2171).
Mit einer entsprechenden Abstinenzweisung dürfen zudem nach § 68b Abs. 3 StGB keine unzumutbaren Anforderungen an die Lebensführung des Verurteilten gestellt werden. Die Abstinenzweisung muss erforderlich und verhältnismäßig im engeren Sinn sein. Letzteres bedeutet, dass sie den Betroffenen nicht übermäßig belasten darf, sondern diesem zumutbar sein. Insoweit stellt § 68b Abs. 3 StGB eine einfachgesetzliche Ausprägung der sich aus dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz ergebenden verfassungsrechtlichen Anforderungen dar. Die Feststellung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne setzt eine Abwägung zwischen den Gemeinwohlbelangen, zu deren Wahrnehmung es erforderlich ist, in die Grundrechte des Betroffenen einzugreifen, und den Auswirkungen auf die Rechtsgüter des Betroffenen voraus. Dabei kann nicht außer Betracht bleiben, dass die Abstinenzweisung strafbewehrt ist. Insoweit unterscheidet sich die Abstinenzweisung im Rahmen der Führungsaufsicht von einer Weisung im Rahmen der Bewährungsaussetzung gern. § 56c StGB, sodass an eine Abstinenzweisung gern. § 68b Abs. 1 S. 1 Nr. 10 StGB unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten erhöhte Anforderungen zu stellen sind. Da im Fall der Verletzung einer Abstinenzweisung gern. § 68 b I Nr. 10 StGB die Möglichkeit der Verhängung einer Strafe als der schärfsten dem Staat zur Verfügung stehenden Sanktion besteht (vgl. § 145 a StGB), kann von dem Betroffenen die Hinnahme des damit verbundenen ethischen Unwerturteils im allgemeinen nur erwartet werden, wenn er überhaupt in der Lage ist, sich normgerecht zu verhalten, und der Schutz überwiegender Interessen anderer oder der Allgemeinheit eine strafrechtliche Sanktionierung gebietet. Von der Verhältnismäßigkeit einer Abstinenzweisung gern. § 68b Abs. 1 S. 1 Nr. 10 StGB wird regelmäßig auszugehen sein, wenn diese gegenüber einer ohne Weiteres zum Verzicht auf den Konsum von Suchtmitteln fähigen Person angeordnet wird und im Fall des erneuten Alkohol- oder Suchtmittelkonsums mit der Begehung erheblicher, die Sicherheitsinteressen der All-gemeinheit betreffender Straftaten zu rechnen ist. Wenn der Verzicht auf den Konsum von Suchtmitteln lediglich vorn Willen und der charakterlichen Festigkeit des Weisungsunterworfenen abhängt, ist es ohne Weiteres zumutbar, für die Dauer der Führungsaufsicht zur Vermeidung weiterer Straftaten einen solchen Verzicht einzufordern. Anders verhält es sich demgegenüber im Fall eines nicht oder erfolglos therapierten langjährigen Suchtkranken. Ungeachtet der Tatsache, dass § 68 b Abs. 1 Nr. 10 StGB nicht zwischen erfolgreich therapierten und nichttherapierten Suchtkranken unterscheidet, stellt sich die Frage der Zumutbarkeit des Verzichts auf den Konsum von Suchtmitteln in beiden Fällen unterschiedlich dar. Für den Suchtkranken beinhaltet die Abstinenzweisung eine deutlich schwerere Belastung. Dennoch wird auch in diesen Fällen nicht ausnahmslos davon ausgegangen werden können, dass die Weisung, auf den Konsum von Suchtmitteln zu verzichten, unzumutbar ist. Vielmehr ist auch insoweit eine Abwägung unter Berücksichtigung der besonderen Umstände des jeweiligen Einzelfalls erforderlich. Dabei sind insbesondere die Fragen, in welchem Umfang überhaupt die Aussicht besteht, den mit einer Abstinenzweisung verfolgten Zweck zu erreichen, ob und inwieweit der Suchtkranke sich (wenn auch erfolglos) Therapieangeboten geöffnet hat und welche Straftaten im Fall weiteren Suchtmittelkonsums zu erwarten sind, in die Abwägung einzustellen. Jedenfalls in Fällen, in denen ein langjähriger, mehrfach erfolglos therapierter Suchtabhängiger aufgrund seiner Suchtkrankheit nicht zu nachhaltiger Abstinenz in der Lage ist und von ihm keine die Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit erheblich beeinträchtigenden Straftaten drohen, ist eine strafbewehrte Abstinenzweisung gem. § 68 b I Nr. 10′ StGB als unzumutbare Anforderung an die Lebensführung iSv § 68 b III StGB und damit zugleich als Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Gebot der Verhältnismäßigkeit anzusehen (vgl. BVerfG, NJW 2016, 2170 Rn. 18-26, beck-online).
Unter Zugrundelegung dieses Prüfungsmaßstabes kann die unter Ziff. 1. d) erteilten Abstinenzweisung in dem Beschluss der 1. Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Bochum vom 08.11.2022 (BI. 19 ff. FA-Heft) nach dem bisherigen Sach- und Verfahrensstand keinen Bestand haben.
…..
2. Indes beruht die Entscheidung der Strafvollstreckungskammer auf einer rechtsfehlerhaften Ermessensausübung bzgl. der Feststellung der Verhältnismäßigkeit im engeren Sinne. Der angefochtene Beschluss unter Ergänzung durch die Nichtabhilfeentscheidung beruht hinsichtlich der Weisung unter Ziff. 1. d) – unter Verstoß gegen die Amtsaufklärungspflicht – auf einer unzureichenden Tatsachengrundlage und entbehrt daher der vorliegend erforderlichen vertieften Begründung.
Die Strafvollstreckungskammer hat im Rahmen ihrer Amtsaufklärungspflicht die für ihre Entscheidungsfindung maßgeblichen Tatsachen festzustellen und in eine ordnungsgemäße Ermessensabwägung einzubeziehen. Das Institut der Führungsaufsicht nach § 68f StGB hat nämlich die Aufgabe, gefährliche oder (rückfall)gefährdete Täter in ihrer Lebensführung in Freiheit über gewisse kritische Zeiträume hinweg zu unterstützen und zu überwachen, um sie von weiteren Straftaten abzuhalten. Führungsaufsicht soll damit nicht nur Lebenshilfe für den Übergang von der Freiheitsentziehung in die Freiheit geben, sondern auch den Verurteilten führen und überwachen. Wenn diese umfassende Sozialisierungshilfe wirksam sein soll, setzt dies Weisungen voraus, die auf den Täter, die Tat(en), deretwegen er verurteilt wurde, und -damit zusammenhängend – auf die von ihm ausgehende Gefährlichkeit hinsichtlich der Begehung weiterer Straftaten möglichst genau abzustimmen sind. Um dieser kriminalpolitischen Zielsetzung gerecht zu werden, ist eine Schematisierung der zu erteilenden Weisungen nicht möglich (vgl. OLG Dresden, Beschluss vom 27.03.2008 – 2 Ws 147/08, NStZ 2008, 572)……“
Wegen der Einzelheiten des konkreten Falles dann bitte im verlinkten Volltext weiterlesen.