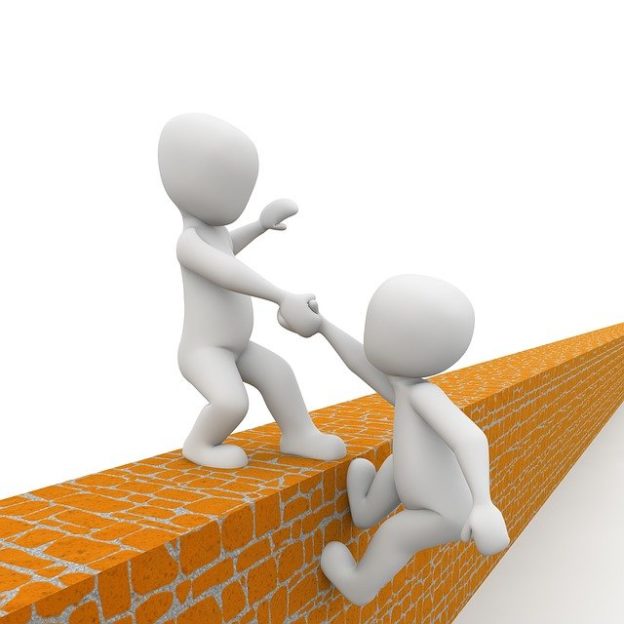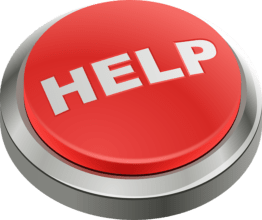Und dann habe ich hier als dritte Entscheidung noch einmal etwas Nachhilfe vom BVerfG, und zwar zur Verletzung der Mitteilungspflicht nach § 243 Abs. 4 Satz 2 StPO. Dazu hat sich das BVerfG im BVerfG, Beschl. v. 08.11.2023 – 2 BvR 294/22 – geäußert.
Der Entscheidung liegt im Wesentlichen folgender Sachverhalt zugrunde:
Das AG Magdeburg hat den Angeklagten wegen gewerbsmäßiger Steuerhehlerei (§ 374 AO) in fünf Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr, deren Vollstreckung es zur Bewährung aussetzte, verurteilt. Während der Hauptverhandlung regte der Verteidiger des Angeklagten ein Rechtsgespräch an, woraufhin die Sitzung für etwa 20 Minuten unterbrochen wurde. Im Sitzungsprotokoll ist (dann) vermerkt:
„Eine Verständigung wurde insoweit herbeigeführt, als dass im Falle eines glaubhaften Geständnisses keine höhere Gesamtfreiheitsstrafe als ein Jahr mit Strafaussetzung zur Bewährung (…) in Betracht komme (…). Der Vertreter der Staatsanwaltschaft tritt neben dem Gericht dieser Verständigung bei.“
Der Verteidiger erklärte für den Angeklagten, dass er die Anklage bestätige.
Der Angeklagte hat gegen das amtsgerichtliche Urteil Sprungrevision eingelegt. Zu deren Begründung wurde u.a. vorgetragen, in der Hauptverhandlung beim AG sei auf Anregung seines Verteidigers eine Erörterung durchgeführt worden. Er und die Öffentlichkeit seien aufgefordert worden, den Sitzungssaal zu verlassen. Der Strafrichter habe in dem Gespräch gesagt: „Wenn es eine Vereinbarung geben solle, müsse sich diese auf die gesamten Anklagevorwürfe beziehen“. Der Strafrichter, der Verteidiger und der Staatsanwalt hätten im weiteren Gesprächsverlauf u.a. ihre Standpunkte zu der Art und Höhe der Strafe im Falle eines Geständnisses ausgetauscht. Nach der Erörterung habe ihm sein Verteidiger erklärt, dass seine Sichtweise zum Eingreifen eines Beweisverwertungsverbots nicht geteilt werde, aber eine Bewährungsstrafe gegen Geständnis bei Einräumung aller Vorwürfe laut Anklage von ca. einem Jahr für realistisch gehalten werde, die ohne Auflage oder Weisung einer Geldzahlung in Betracht komme. Weitere Umstände der Erörterung seien ihm nicht mitgeteilt worden.
Das OLG Naumburg (sic!) hat die Revision nach § 349 Abs. 2 StPO als unbegründet verworfen. Die Verfassungsbeschwerde des Angeklagten hatte – teilweise – Erfolg. Das BVerfG hat das Verfahren an das OLG zurückverwiesen.
Auch hier stelle ich wegen des Umfangs der Entscheidung keine Auszüge ein, sondern verweise auf den verlinkten Volltext. Die Argumentation des BVerfG lässt sich etwa wie folgt zusammenfassen:
- Das OLG Naumburg hat Bedeutung und Tragweite des Rechts auf ein faires Verfahren (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 20 Abs. 3 GG) für die Auslegung und Anwendung der Vorschriften über die Verständigung im Strafprozess nicht hinreichend berücksichtigt.
- Das OLG hat zudem die verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Mitteilungspflicht aus § 243 Abs. 4 Satz 2 StPO sowie an die Beurteilung, ob das amtsgerichtliche Urteil auf einer Verletzung dieser Mitteilungspflicht beruhe, verkannt.
- Transparenz und Öffentlichkeit sind im Regelungskonzepts der Verständigung eine wichtige Säule, die die vom Gesetzgeber als erforderlich bewertete „vollumfängliche“ Rechtsmittelkontrolle ermöglichen und wirksam ausgestalten soll.
- Der Inhalt des während der Unterbrechung der Hauptverhandlung vor dem AG geführten Gesprächs zwischen dem Vertreter der Staatsanwaltschaft, dem Strafrichter und dem Verteidiger des Angeklagten unterfiel jedenfalls ab dem Zeitpunkt der Mitteilungspflicht nach § 243 Abs. 4 StPO, als der Strafrichter durch die Aussage „Wenn es eine Vereinbarung geben solle, müsse sich diese auf die gesamten Anklagevorwürfe beziehen“ ausdrücklich die Möglichkeit einer Vereinbarung in Betracht gezogen hatte. Spätestens ab diesem Moment ist die Erörterung offensichtlich auf eine einvernehmliche Verfahrenserledigung gerichtet gewesen.
- Die Mitteilungspflicht ist , denn die Mitteilung des Strafrichters in der Hauptverhandlung gibt den wesentlichen Inhalt des Verständigungsgesprächs nicht vollständig wieder. Der Strafrichter beschränkt sich nämlich darauf, kundzutun, dass eine Verständigung herbeigeführt worden sei und welche Strafe der Angeklagte im Falle eines Geständnisses zu erwarten habe. Nach § 243 Abs. 4 StPO hätte der Strafrichter jedoch auch mitteilen müssen, welche Standpunkte die einzelnen Gesprächsteilnehmer vertraten, von welcher Seite die Frage einer Verständigung aufgeworfen wurde und ob sie bei den anderen Gesprächsteilnehmern auf Zustimmung oder Ablehnung stieß.
- Das OLG hat bei der Beruhensprüfung das Beruhen des Urteils des AG auf der Verletzung der Mitteilungspflicht mit verfassungsrechtlich nicht tragfähiger Argumentation ausgeschlossen. Es hat die verfassungsrechtlichen Anforderungen des § 243 Abs. 4 StPO bereits aus dem Grund verfehlt, weil die Frage des Beruhens offensichtlich allein unter dem Gesichtspunkt einer Einwirkung auf das Aussageverhalten des Angeklagten geprüft und die Bedeutung der von dem Verstoß in erster Linie betroffenen, auch dem Schutz des Angeklagten dienenden Kontrollmöglichkeit der Öffentlichkeit außer Acht gelassen worden ist.
- Es sei bereits nicht ersichtlich, dass das OLG sich mit dem Gesichtspunkt auseinandergesetzt hätte, dass richterliche und nichtrichterliche Mitteilungen nicht von identischer Qualität sein können, sodass auch bei erfolgter Unterrichtung durch den Verteidiger das richterliche Mitteilungsdefizit Auswirkungen auf das Aussageverhalten des Angeklagten gehabt haben könnte.
Auch hier ist man – zumindest ich – wie beim BVerfG, Beschl. v. 20.12.2023 – 2 BvR 2103/20 zur Verurteilung nach einem verständigungsbasierten Geständnis erstaunt, mit welcher Nonchalance AG, OLG und auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft die Rechtsprechung des BVerfG und des BGH zu den maßgeblichen Fragen schlicht übersehen. Ob bewusst oder unbewusst, ist letztlich ohne Belang, denn beides ist gleich unverständlich. Es würde zu weit führen, an dieser Stelle die maßgeblichen obergerichtliche Rechtsprechung im Einzelnen darzustellen. Festzuhalten ist aber, dass für das BVerfG und ihm letztlich folgend auch für den BGH die Mitteilungspflicht des § 243 Abs. 4 Satz 2 StPO einer der Grundpfeiler der Verständigungsregelung ist. Es wird immer wieder die Bedeutung dieser Mitteilungspflicht im Hinblick auf die Rechte des Angeklagten aber auch der Öffentlichkeit betont. Ergebnis dieser Rechtsprechung ist, dass die Mitteilungspflicht vom inhaltlichen Umfang her sehr weit geht und das auch Auswirkungen auf die Beruhensprüfung des Revisionsgerichts hat. Darauf weist das BVerfG noch einmal hin. Man kann nur hoffen, dass dieser Hinweis auch gelesen werden und zumindest dann diese Rechtsprechung bei AG und OLG bekannt ist. Bisher scheint das nicht der Fall zu sein.