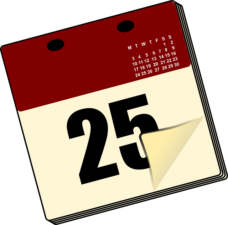Heute dann ein wenig OWi, und zwar zunächst mit einer Entscheidung u.a. zum Fahrverbot, und zwar der OLG Schleswig, Beschl. v. 19.06.2024 – I ORbs 60/24.
Das AG hat gegen den Betroffenen wegen fahrlässigen Überschreitens der zulässigen Höchstgeschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften um 32 km/h eine Geldbuße von 600,00 € festgesetzt. Es hat im Rechtsfolgenausspruch von der Verhängung des Regelfahrverbotes abgesehen und stattdessen die Geldbuße verdreifacht.
Hiergegen richtet sich die Rechtsbeschwerde des Betroffenen, welche er mit der allgemeinen Sachrüge begründet. Die Generalstaatsanwaltschaft hat beantragt, die Rechtsbeschwerde als unbegründet zu verwerfen. Sie geht u.a. davon aus, dass es an einer Benachteiligung des Betroffenen durch die vom AG letztlich vorgenommene Festsetzung der Geldbuße fehle, da diese im Vergleich zum Fahrverbot das mildere Ahndungsmittel sei. Das hat das OLG anders gesehen:
„b) Auch im Rechtsfolgenausspruch ist der Betroffene nach Auffassung des Senates beschwert.
Zwar führt die Generalstaatsanwaltschaft zutreffend aus, dass unter dem Aspekt des Verschlechterungsverbots eine (erhöhte) Geldbuße gegenüber einem Fahrverbot die mildere Sanktion ist und deshalb auch auf ein Rechtsmittel allein zugunsten eines Betroffenen bzw. bei Anwendung von § 301 StPO verhängt werden darf (vgl. u.a. OLG Hamm, Beschluss vom 2. Juli 2007 – 3 Ss OWi 360/07 –, juris). Dieser Rechtsgedanke beruht allerdings auf einer abstrakten Differenzierung zwischen Geldbuße und Fahrverbot als unterschiedliche Sanktionen. Dies ist zu unterscheiden von der Frage, ob die rechtsfehlerhafte Anwendung dieser Sanktionsmöglichkeiten den Betroffenen dann konkret beschwert, wenn von der härteren Sanktion gegen Erhöhung der milderen Sanktion abgesehen wird. Würde die Beschwer unter dem Gesichtspunkt verneint, dass „nur“ auf eine mildere Sanktion erkannt wurde und ließe man dabei außer Betracht, dass diese nachteilig erhöht wurde, wäre es dem Rechtsbeschwerdegericht stets verwehrt, den Rechtsfolgenausspruch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren zu überprüfen, wenn das Tatgericht von der härteren Sanktion des Fahrverbotes abgesehen hat. Damit wäre dem Rechtsbeschwerdegericht auch nicht mehr möglich nachzuprüfen, ob das Tatgericht die Wechselwirkung zwischen Geldbuße und Fahrverbot erkannt und dessen Bedeutung im Rechtsfolgenausspruch beachtet hat. Das sieht auch die Generalstaatsanwaltschaft offensichtlich nicht so, denn sie nimmt wirtschaftliche Erwägungen dahingehend vor, ob der Betroffene durch die Erhöhung der Geldbuße in der Gesamtschau beschwert ist und verneint dies im Ergebnis. Die diesbezüglichen Erwägungen sind jedoch hypothetisch und finden in den Urteilsgründen keine Stütze. Genau hieran zeigt sich aber, dass es dem Urteil umfassend an Feststellungen mangelt, die den Rechtsfolgenausspruch tragen könnten. Der Senat als Rechtsbeschwerdegericht kann nämlich eigene Erwägungen nicht anstelle des Tatrichters setzen. Dies folgt schon aus § 79 Abs. 6 OWiG, wonach eine eigene Entscheidung zwingend voraussetzt, dass die Feststellungen des Tatgerichts hierfür ausreichen.
Die Beschwer des Betroffenen liegt nach Auffassung des Senats schon darin, dass die Geldbuße signifikant erhöht, nämlich verdreifacht, worden ist. Denn hierin liegt eine wirtschaftliche Beschwer innerhalb der verhängten Sanktion, die den Betroffenen zu Unrecht benachteiligen kann. § 4 Abs. 4 BKatV regelt nämlich, dass bei einem Absehen vom Fahrverbot die Geldbuße angemessen (Hervorhebung durch den Senat) erhöht werden soll. Hierin kommt die Wechselwirkung beider Sanktionen zum Ausdruck, deren Beachtung für das Rechtsbeschwerdegericht überprüfbar sein muss. Gleiches gilt für die innerhalb des Ermessensspielraums des Tatrichters maßgeblich zu berücksichtigenden Umstände, so u.a. die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse des Betroffenen soweit sie entscheidungsrelevant sind. Auch wenn die Zumessungserwägungen des Tatrichters nur einer eingeschränkten Prüfung des Rechtsbeschwerdegerichts unterliegen, hat das Rechtsbeschwerdegericht zu prüfen, ob die tatrichterlichen Erwägungen ausreichend sind oder aber lückenhaft und in sich widersprüchlich. So liegt es hier. Mangels Feststellungen zu den persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen kann der Senat nicht überprüfen, ob die Erhöhung der Geldbuße um das Dreifache angemessen im Sinne von § 4 Abs. 4 BKatV ist und der Wechselwirkung zwischen Geldbuße und Fahrverbot hinreichend Rechnung getragen wurde. Die Feststellung des Amtsgerichts „Die Verdreifachung der Regelgeldbuße erfolgte unter Berücksichtigung der Gesamtumstände.“ stellt eine inhaltslose Floskel dar, weil das Urteil sich zu diesen „Gesamtumständen“ nicht verhält. Auch im Rechtsfolgenausspruch war das Urteil daher mit den zugrundeliegenden Feststellungen aufzuheben.“
Unschön dann aber:
„Für die neue Hauptverhandlung weist der Senat ergänzend auf Folgendes hin:
Durchgreifenden Bedenken dürfte der Schuldspruch auch im Hinblick auf die Annahme von Fahrlässigkeit begegnen. Zunächst genügen die tatsächlichen Feststellungen zu der Beschilderung nicht, soweit das Amtsgericht lediglich ausgeführt hat, die zulässige Geschwindigkeit sei „in diesem Bereich“ beschränkt. Auch verhält sich das Urteil nicht dazu, ob der Betroffene die Beschilderung wahrgenommen oder aber (nur) übersehen hat. Angesichts von fünf einschlägigen Vorerkenntnissen im FAER, davon allein drei im Jahr 2022, und der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung um 32 km/h (ein Drittel der zulässigen Höchstgeschwindigkeit) hatte das Amtsgericht allerdings erhebliche Veranlassung, eine vorsätzliche Tatbegehung durch den Betroffenen zu prüfen. Insoweit lässt das Urteil unter Ziffer II besorgen, dass sich der Tatrichter dieser Möglichkeit gar nicht bewusst war, weil Erwägungen hierzu vollständig fehlen.
Kann ein Fahrverbot aufgrund des insoweit geltenden Verschlechterungsverbots zwar nicht mehr angeordnet werden, so ist es dem Amtsgericht allerdings noch möglich, hinsichtlich der Schuldform neue Feststellungen zu treffen und die sich hierzu aufdrängenden Erwägungen anzustellen. Das Verschlechterungsverbot gilt für die Verurteilung wegen einer nachteiligen Schuldform nicht (KG, Beschluss vom 30. Januar 2023 – 3 ORbs 5/23 – 122 Ss 138/22 -, bei BeckRS), so dass ggf. die Regelbuße nach § 3 Abs. 4a BKatV zwingend zu verdoppeln wäre.“