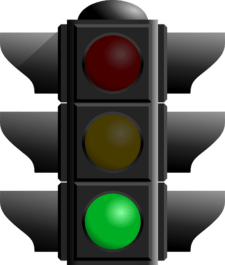Der Kläger verlangt in dem Verfahren von der Beklagten die Feststellung der Haftung für einen Verkehrsunfall, der sich am 11.08.2018 auf einer BAB ereignet hate. Der Kläger, ein zum Unfallzeitpunkt gesunder zehnjähriger Junge, saß angeschnallt im Fahrzeug seiner Mutter, die als Halterin ihr Fahrzeug VW Golf zum Unfallzeitpunkt steuerte, auf einem Kindersitz im linken Bereich der Fahrzeugrückbank. Vor dem klägerischen Fahrzeug fuhr der Beteiligte E. mit seinem Fahrzeug welches bei der Beklagten haftpflichtversichert ist. Beide Fahrzeuge befuhren die rechten Fahrspur und verlangsamten ihre Fahrt, als sich vor ihnen ein Stau aufbaute.
Von hinten kommend auf der Überholspur näherte sich das Fahrzeug Dodge Ram 1500 der Beteiligten B. . Die Beteiligte B., bei der nach dem Unfall eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt worden war (AAK von 1,1 Promille), wechselte aus ungeklärtem Grund von der Überholspur mit ca. 120 km/h nach rechts und prallte ungebremst auf das klägerische Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieses in das vor ihm fahrende Fahrzeug des Beteiligten E. geschleudert. Das Beklagtenfahrzeug wurde seinerseits ebenfalls gegen das voranfahrende Fahrzeug der Beteiligten K. geschoben. Insgesamt waren vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.
Durch den Unfall erlitt der Kläger schwere, lebensgefährliche Verletzungen.
Die klägerische Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung und diejenige der Beteiligten B. erklärten eine gesamtschuldnerische Haftung für die Schäden des Klägers. Mit seiner Klage begehrt der Kläger eine gleichlautende Erklärung von der Beklagten, die dies ablehnt. Die Parteien streiten darum, ob der zweite Aufprall des klägerischen Fahrzeugs auf das Beklagtenfahrzeug zu weiteren Verletzungen beim Kläger geführt hat und ob somit auch die Beklagte für die Unfallfolgen des Klägers einstandspflichtig ist.
Das LG hat die Klage ohne Beweisaufnahme abgewiesen. Zur Begründung hat es ausgeführt, der Unfall sei für den Beteiligten E. ein unabwendbares Ereignis gem. § 17 Abs. 3 StVG gewesen. Das Fahrzeug sei bei einer wertenden Betrachtung nicht gem. § 7 StVG „bei Betrieb“ gewesen. Allein die Tatsache, dass es ein Hindernis gebildet habe, reiche nicht aus, um eine Gefährdungshaftung anzunehmen. Weder seine Fahrweise noch sein Betriebsvorgang hätten das Unfallgeschehen geprägt.
„Der Kläger hat einen Anspruch auf die Feststellung gem. § 256 Abs. 1 ZPO, dass die Beklagte als Gesamtschuldnerin neben den im Antrag genannten Gesamtschuldnern für alle Folgen aus dem Verkehrsunfall vom 11. August 2018 gem. § 7 Abs. 1 StVG, § 115 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 VVG, § 421 BGB haftet.
a) Gem. 7 Abs. 1 StVG ist der Halter zum Schadensersatz verpflichtet, wenn bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs ein Mensch verletzt wird. Gem. § 7 Abs. 2 StVG ist die Ersatzpflicht ausgeschlossen, wenn der Unfall durch höhere Gewalt verursacht wird.
aa) Die Ersatzpflicht der Beklagten ist nicht durch höhere Gewalt ausgeschlossen. Gem. 7 Abs. 2 StVG beruht auf höherer Gewalt ein außergewöhnliches, betriebsfremdes, von außen durch elementare Naturkräfte oder durch Handlungen dritter (betriebsfremder) Personen herbeigeführtes und nach menschlicher Einsicht und Erfahrung unvorhersehbares Ereignis, das mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch nach den Umständen äußerste, vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann und das auch nicht im Hinblick auf seine Häufigkeit in Kauf genommen zu werden braucht (vgl. Hentschel, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, Kommentar, 45. Aufl. 2019, § 7 StVG, Rn. 32; Filthaut, Haftpflichtgesetz, 6. Aufl., § 1 Rn. 158; Steffen, DAR 1998, 135; jeweils mwN).
Zusammengefasst muss es sich um eine Einwirkung von außen handeln, die außergewöhnlich und nicht abwendbar ist. Alle drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wenn höhere Gewalt vorliegen soll (vgl. Senat, Urteil vom 12. Mai 2005 – 14 U 231/04, Rn. 13, juris).
Dies ist vorliegend nicht der Fall. Es fehlt bereits an einer von außen kommenden, mithin an einer betriebsfremden Einwirkung auf das Fahrzeug der Beklagten. Zwar kann eine solche Einwirkung grundsätzlich nicht nur in einem Naturereignis, sondern auch in einem menschlichen Verhalten bestehen. Hierunter fallen aber insbesondere vorsätzliche Eingriffe dritter Personen in den Verkehr, z. B. in Selbsttötungsabsicht, durch Sabotageakte oder durch absichtliches Stoßen eines Unbeteiligten vor ein Fahrzeug (vgl. Senat, Urteil vom 12. Mai 2005 – 14 U 231/04, Rn. 14f., juris).
Weder bei der Kollision zwischen der Beteiligten B. und dem klägerischen Fahrzeug noch bei der darauffolgenden Kollision zwischen dem Beklagten- und dem Klägerfahrzeug hat es sich um vorsätzliches Dazwischentreten eines Dritten gehandelt, der den Zurechnungszusammenhang zum Beklagtenfahrzeug unterbrechen könnte. Vielmehr hat sich ein typisches Risiko verwirklicht, das auf Autobahnen aufgrund der dort gefahrenen Geschwindigkeiten besteht.
Überdies stellt auch das Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer keine höhere Gewalt dar. Auch grobe Regelverstöße sind bereits wegen ihrer Häufigkeit nicht geeignet, einen Haftungsausschluss zu begründen (vgl. BGH, Urteil vom 15. November 1966 – VI ZR 280/64, Rn. 13, juris).
Auf die noch vom Landgericht thematisierte Frage, dass der Unfall vom Beteiligten E. nicht hätte verhindert werden können, kommt es nicht an, weil es bereits an den beiden ersten Begriffsmerkmalen der höheren Gewalt fehlt. Nach der Änderung des § 7 Abs. 2 StVG durch das Zweite Gesetz zur Änderung schadensersatzrechtlicher Vorschriften vom 19. Juli 2002 (BGBl. I S. 2674) begründet eine mögliche Unvermeidbarkeit des Unfalls für sich allein keinen Haftungsausschluss zugunsten des Fahrzeughalters mehr.
bb) Die Verletzungen des Klägers sind bei dem Betrieb des Beklagtenfahrzeugs entstanden. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, Urteil vom 26. März 2019 – VI ZR 236/18, Rn. 8; Urteil vom 11. Februar 2020 – VI ZR 286/19, juris) ist das Haftungsmerkmal „bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs“ entsprechend dem umfassenden Schutzzweck der Norm weit auszulegen (vgl. die ähnliche Auslegung der „Verwendung eines Fahrzeugs“ im EU-Recht, vgl. EuGH, Urteil vom 20. Juni 2019 – C-100/18, VersR 2019, 1008). Denn die Haftung nach 7 Abs. 1 StVG ist der Preis dafür, dass durch die Verwendung eines Kraftfahrzeugs erlaubterweise eine Gefahrenquelle eröffnet wird. Die Vorschrift will alle durch den Kraftfahrzeugverkehr beeinflussten Schadensabläufe erfassen. Ein Schaden ist demgemäß bereits dann „bei dem Betrieb“ eines Kraftfahrzeugs entstanden, wenn sich in ihm die von dem Kraftfahrzeug ausgehenden Gefahren ausgewirkt haben, d.h. wenn bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung das Schadensgeschehen durch das Kraftfahrzeug (mit)geprägt worden ist (vgl. BGH, Urteile vom 24. März 2015 – VI ZR 265/14, Rn. 5; vom 21. Januar 2014 – VI ZR 253/13, Rn. 5; vom 31. Januar 2012 – VI ZR 43/11, Rn. 17; Senat, Urteil vom 22. Januar 2020 – 14 U 150/19, Rn. 42, alle zitiert nach juris). Erforderlich ist aber, dass die Fahrweise oder der Betrieb des Kraftfahrzeugs zu dem Unfallgeschehen beigetragen hat (BGH, Urteil vom 21. September 2010 – VI ZR 263/09, Rn. 3, juris).
cc) Die Grenzen einer Haftung aus 7 StVG ergeben sich ebenfalls aus dem Schutzzweck der Vorschrift (BGHZ 79, 259, 263). Die Haftung wird nicht schon durch jede Verursachung eines Schadens begründet, der im weitesten Sinne im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges ausgelöst worden ist. Eine Haftung tritt vielmehr erst dann ein, wenn das Schadensereignis dem Betrieb eines Kraftfahrzeuges nach dem Schutzzweck der Gefährdungshaftung auch zugerechnet werden kann.
Gemessen daran befand sich das Fahrzeug des Beteiligten E. im Betrieb als es mit dem klägerischen Fahrzeug kollidierte. Es diente seiner Fortbewegungs- und Transportfunktion als Verkehrsmittel als sich der Unfall ereignete. Es hat insofern im Sinne einer Mitursächlichkeit durch seinen Betrieb („fahren“) zu dem Unfallgeschehen beigetragen. Im Sinne einer conditio sine qua non könnte das fahrende Beklagtenfahrzeugs auf der BAB 20 nicht weggedacht werden, ohne dass der Unfall passiert wäre.
Soweit die Beklagte meint, der Unfall habe nichts mit der spezifischen Gefährdung eines Fahrzeuges zu tun, weswegen es nicht mehr in den Bereich der Gefahren falle, um derentwillen die Rechtsnorm erlassen worden sei, folgt der Senat dem nicht.
Die Gefährdungshaftung des § 7 StVG zielt gerade darauf ab, das Gefahrenpotential zu erfassen, das entsteht, wenn sich Kraftfahrzeuge im Straßenverkehr bewegen. Geradezu typische risikoreiche Situationen entstehen auf Autobahnen, auf denen viele Verkehrsteilnehmer ihre Fahrzeuge mit hohen Geschwindigkeiten fahren. Entsteht sodann – wie hier – am Ende eines plötzlich aufgebauten Staus ein Auffahrunfall, hat sich genau das Risiko verwirklicht, für das § 7 StVG mit der Gefährdungshaftung erlassen wurde. Es geht bei § 7 StVG nicht um den Ausgleich von Verhaltensunrecht, sondern um eine erfolgsbezogene Haftung (vgl. BGH, Urteil vom 17. März 1992 – VI ZR 62/91, Rn. 10, juris; König, in: Hentschel/König/Dauer, Straßenverkehrsrecht, Kommentar, 45. Aufl. 2019, § 7 StVG, Rn. 1 mwN).
Erst wenn sich in einem Schadensfall ein Risiko verwirklicht, das aus einem eigenständigen Gefahrenkreis stammt, wird dieser nicht mehr vom Schutzzweck der Norm des § 7 StVG erfasst. Der Bundesgerichtshof geht dabei von einer weiten wertenden Betrachtung aus, die typische Gefahrenquellen des Straßenverkehrs erfassen soll (vgl. BGH, Urteil vom 11. Februar 2020 – VI ZR 286/19; Urteil vom 7. Februar 2023 – VI ZR 87/22, beide juris, zur Anhängerhaftung).
(a) Ein eigenständiger neuer Gefahrenkreis, der geeignet gewesen wäre, die Gefährdungshaftung entfallen zu lassen (vgl. BGH, Urteil vom 2. Juli 1991 – VI ZR 6/91, juris [Schweinemast]; Senat, Urteil vom 18. November 2020 – 14 U 84/20, nachgehend BGH, Beschluss vom 19. Oktober 2021 – VI ZR 1339/20, Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen [Laternenmast]) oder eine Selbstgefährdung (vgl. BGH, Urteil vom 3. Juli 1990 – VI ZR 33/90, juris, Herausforderungsfall), liegen nicht vor, wie ausgeführt.
(b) Soweit die Beklagte meint, der vorliegende Unfall sei mit der Konstellation eines sog. berührungslosen Unfalls vergleichbar, folgt der Senat dem ebenfalls nicht.
Voraussetzung für die Zurechnung des Betriebs eines Kraftfahrzeugs zu einem schädigenden Ereignis ist, dass über seine bloße Anwesenheit an der Unfallstelle hinaus das Fahrverhalten seines Fahrers in irgendeiner Art und Weise das Fahrmanöver des Unfallgegners beeinflusst hat (vgl. st. Rspr. BGH, Urteil vom 22. November 2016 – VI ZR 533/15, Rn. 14 mwN, juris).
Dies ist vorliegend der Fall. Das Beklagtenfahrzeug war unmittelbar an einem Unfall beteiligt, es handelte sich nicht um einen berührungslosen Unfall oder eine vergleichbare Konstellation. Das Risiko der Gefahrenquelle hat sich – im Gegenteil – realisiert.
dd) Der Unfall stand ferner in einem engen zeitlichen und örtlichen Zusammenhang mit dem Betrieb des Beklagtenfahrzeugs. Für die Zurechnung der Betriebsgefahr kommt es damit maßgeblich darauf an, dass der Unfall in einem nahen örtlichen und zeitlichen Zusammenhang mit einem bestimmten Betriebsvorgang oder einer bestimmten Betriebseinrichtung des Kraftfahrzeuges steht (BGH, Urteil vom 24. März 2015 – VI ZR 265/14, Rn. 5 mwN, juris). Auch dies war der Fall (s.o.).
ee) Die Verletzungen des Klägers sind kausal auf das Unfallereignis mit dem Beklagtenfahrzeug zurückzuführen…..“
 Und dann kommt hier ein kleiner Überblick zu verkehrsrechtlichen Entscheidungen, die nicht vom BGH stammen, und zwar auch wieder nur die Leitsätze und: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Und dann kommt hier ein kleiner Überblick zu verkehrsrechtlichen Entscheidungen, die nicht vom BGH stammen, und zwar auch wieder nur die Leitsätze und: Ohne Anspruch auf Vollständigkeit.