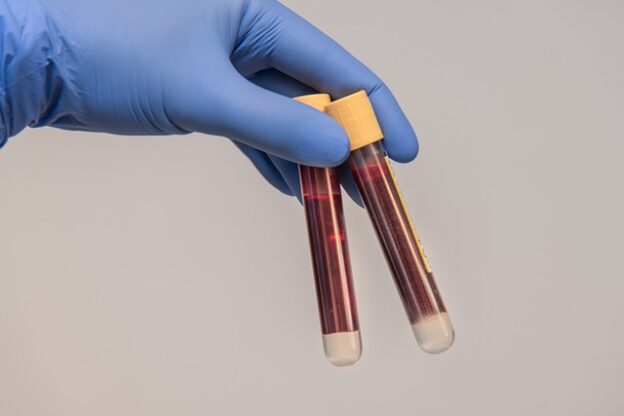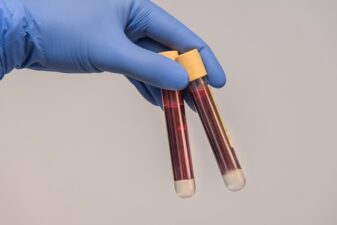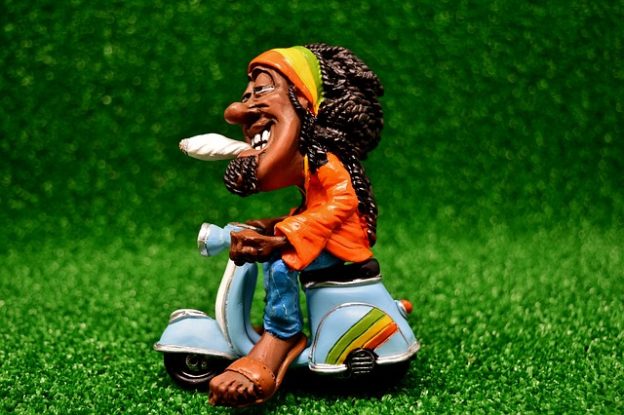Bild von Christian Dorn auf Pixabay
Und im zweiten Posting zum KCanG dann das AG Dortmund, Urt. v. 11.04.2024 – 729 OWi-251 Js 287/24-27/24. Ich weiß nicht so recht, wie ich mit dem Urteil, das den Betroffenen vom Vorwurf einer Drogenfahrt (§ 24a Abs. 2 StVG) freigesprochen hat, umgehen soll.
Zur Erläuterung vorab: § 44 KCanG enthält einen an eine vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr eingesetzte interdisziplinäre Arbeitsgruppe gerichteten Auftrag. Danach war bis zum 31.03.2024 der Wert einer Konzentration von Tetrahydrocannabinol im Blut vorzuschlagen, bei dessen Erreichen nach dem Stand der Wissenschaft das sichere Führen eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr nicht mehr regelmäßig gewährleistet ist. In Umsetzung dieses Auftrags hat die Expertengruppe am 28.03.2024 vorgeschlagen, in § 24a StVG einen gesetzlichen Wirkungsgrenzwert von 3,5 ng/ml THC im Blutserum zu verankern. Zudem hat das Gremium unter Hinweis auf die besonderen Gefahren von Mischkonsum vorgeschlagen, für Cannabiskonsumenten ein absolutes Alkoholverbot festzuschreiben, entsprechend der Regelung für Fahranfänger in § 24c StVG.
Ob und wie der Gesetzgeber diesen Vorschlägen folgen wird, muss man mal sehen. M.E. wäre abzuwarten. Aber: Nicht so das AG Dortmund. Das hat den Betroffenen vom Vorwurf einer Drogenfahrt nach § 24a StVG aus tatsächlichen Gründen frei gesprochen. Festgestellt war eine Fahrt mit einem Pkw unter der Wirkung berauschender Mittel, nämlich Cannabis. Entnommen worden war eine Blutprobe, die eine THC-Konzentration von 3,1 ng/ml aufgewiesen hat. Das AG meint:
„Der Betroffene war aus tatsächlichen Gründen freizusprechen.
Der bisherige Grenzwert für § 24a Abs. II StVG lag für Cannabis bei 1,0 ng/ml.
Dabei ist die Situation derart, dass bislang lediglich der Wirkstoff THC in der Anlage zu § 24a StVG genannt ist, jedoch nicht der im Straßenverkehr maßgebliche Grenzwert. Dieser wurde in der Vergangenheit von der Rechtsprechung festgesetzt anhand rechtsmedizinischer Vorschläge.
Im Rahmen des Cannabis-Gesetzes und der Teillegalisierung von Cannabis hat der Gesetzgeber in § 44 KCanG ausdrücklich eine Regelung getroffen, wie weiter zu verfahren ist:
Hiernach sollte eine nach dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr eingesetzte Arbeitsgruppe bis zum 31.03.2024 den Wert einer Konzentration von THC im Blut vorschlagen, bei dessen Erreichen nach dem Stand der Wissenschaft das sichere Führen eines Kraftfahrzeuges im Straßenverkehr regelmäßig nicht mehr gewährleistet ist. Diese Arbeitsgruppe hat – allgemein bekannt aufgrund einer Veröffentlichung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr – den Grenzwert auf 3,5 ng/ml vorgeschlagen. In der Pressemitteilung des Ministeriums heißt es u.a.:
„…Die wissenschaftlichen Experten geben danach folgende Empfehlungen ab:
Im Rahmen des § 24a StVG wird ein gesetzlicher Wirkungsgrenzwert von 3,5 ng/ml THC Blutserum vorgeschlagen. Bei Erreichen dieses THC-Grenzwertes ist nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung beim Führen eines Kraftfahrzeuges nicht fernliegend, aber deutlich unterhalb der Schwelle, ab der ein allgemeines Unfallrisiko beginnt….Bei dem vorgeschlagenen Grenzwert von 3,5 ng/ml THC im Blutserum handelt es sich nach Ansicht der Experten um einen konservativen Ansatz, der vom Risiko vergleichbar sei mit einer Blutalkoholkonzentration von 0,2 Promille. THC im Blutserum ist bei regelmäßigem Konsum noch mehrere Tage nach dem letzten Konsum nachweisbar. Daher soll mit dem Vorschlag eines Grenzwertes von 3,5 ng/ml THC erreicht werden, dass – anders als bei dem analytischen Grenzwert von 1 ng/ml THC – nur diejenigen sanktioniert werden, bei denen der Cannabiskonsum in einem gewissen zeitlichen Bezug zum Führen eines Kraftfahrzeugs erfolgte und eine verkehrssicherheitsrelevante Wirkung beim Führen eines Kraftfahrzeugs möglich ist….“
Das Gericht sieht hierin ein sogenanntes antizipiertes Sachverständigengutachten, dass auch nicht durch anderweitige Vorschläge/Kritik aus Politik, Justiz, Medizin oder dem Bereich der Polizei infrage gestellt wird. Dies gilt umso mehr, dass ausweislich des § 44 KCanG keinerlei weiterer Schritt vorgesehen ist, der die Umsetzung des Grenzwertes in die verkehrsrechtliche Praxis vorsieht. Die aus der Gesetzesbegründung sich insoweit ergebende Absicht einer Kodifizierung des gefundenen Wertes spricht nicht gegen die Anwendung des Wertes bereits zum jetzigen Zeitpunkt.
Die Situation ist nämlich in rechtlicher Hinsicht hinsichtlich des § 24a StVG gleichgeblieben. Lediglich die Risikobewertung hat sich hinsichtlich des Cannabis geändert, so dass der neue Grenzwert von 3,5 ng/l seit dem 01.04.2024 für gerichtliche Entscheidungen maßgeblich ist.“
M.E. zumindest mutig und nicht unbedenklich. Die „Empfehlung“ der Expertenarbeitsgruppe ist also ein „antizipiertes Sachverständigengutachten“ – den Begriff kennen wir aus dem OWi-Recht, wo ihn das OLG Frankfurt am Main bei Messverfahren eingeführt hat? Ach so. Ich sehe da nichts von einem Sachverständigengutachten, sondern zunächst mal nur eine Empfehlung, mehr nicht.
Und wie kommt diese Empfehlung, sorry, das „antizipierte Sachverständigengutachten“, ins Verfahren? Hat man ein Mitglied der Expertengruppe als Sachverständigen gehört? Nein, natürlich nicht, sondern es hat ein Zitat aus der Pressemitteilung (!!!) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr gereicht. Auch da habe ich erhebliche Probleme. Das AG geht offenbar von „gerichtsbekannt“ oder „allgemein bekannt“ aus. Na ja, ob das stimmt und reicht?
Und es stimmt m.E. auch nicht, dass die Empfehlung nicht durch „Vorschläge/Kritik aus Politik, Justiz, Medizin oder dem Bereich der Polizei infrage gestellt“ wird. Zumindest ist schon mal das „Verkehrspolizeiliche Votum zur Legalisierung von Cannabis und zur
Festlegung eines THC- Grenzwertes“ wohl anderer Auffassung. Und auch beim “ Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr“ scheint man anderer Auffassung zu sein. Jedenfalls hat man dort eine kritische „Stellungnahme von Prof. Dr. Daldrup zu dem Ergebnis der im Rahmen des Konsumcannbisgesetzes (KCanG) vom BMDV im Dezember 2023 eingerichteten unabhängigen, interdisziplinären Arbeitsgruppe mit Experten aus den Bereichen Medizin, Recht und Verkehr sowie dem Bereich der Polizei“ auf der Homepage eingestellt. Mehr habe ich dann nicht gesucht. Die beiden „Stellungsnahmen“ zur „Empfehlung“ waren einfach zu finden, wenn man sie finden wilöö. Das AG offenbar nicht.
Ich kann leider derzeit nicht feststellen, ob das Urteil rechtskräftig ist oder ob die StA den Gang zum OLG Hamm unternommen hat. Jedenfalls steht das Urteil ohne Hinweis auf „abgekürzt“ bei NRWE. Es würde mich schon interessieren, was das OLG Hamm dazu sagt, dass der AG sich zum Gesetzgeber aufgeschwungen hat.
Zumindest m.E. ein wenig voreilig. Ich würde mich auf dieses Urteil nicht unbedingt bei anderen AG berufen wollen.