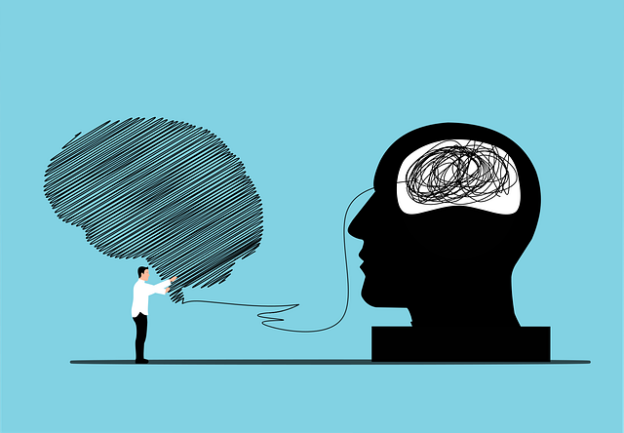Heute geht es dann auf in die 25. KW des Jahres 2024. Zum Wochenauftakt gibt es zwei Entscheidungen zu Bewährungsfragen, beide kommen aus dem Vollstreckungsbereich.
Zunächst kommt hier der OLG Naumburg, Beschl. v. 27.05.2024 – 1 Ws 214/24 B-Sonst. Der Verurteilte verbüßt seit dem 24.11.2023 eine Strafe wegen vorsätzlicher Insolvenzverschleppung Freiheitsstrafe von acht Monaten. Zwei Drittel der Strafe waren am 03.05.2024 verbüßt. Das Strafende ist auf den 23.07.2024 notiert. Die Strafvollstreckungskammer hat die Aussetzung der Restfreiheitsstrafe nach Verbüßung von zwei Dritteln abgelehnt. Dagegen die soofortige Beschwerde, die beim OLG Erfolg hatte:
„Die nach § 454 Abs. 3 Satz 1 StPO statthafte, form- und fristgerecht (§ 311 Abs. 2 StPO) eingelegte sofortige Beschwerde des Verurteilten ist begründet. Die Voraussetzungen für eine Aussetzung der Vollstreckung der Strafreste zur Bewährung und eine bedingte Entlassung des Verurteilten aus der Strafhaft nach § 57 Abs. 1 StGB liegen vor.
1. Die Vollstreckung des Restes einer zeitigen Freiheitsstrafe ist – nach Verbüßung von zwei Dritteln der verhängten Strafe und bei Einwilligung der verurteilten Person, so wie hier – zur Bewährung auszusetzen, wenn dies unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantwortet werden kann (§ 57 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 StGB). Bei dieser Entscheidung sind namentlich die Persönlichkeit des Verurteilten, sein Vorleben, die Umstände seiner Tat, das Gewicht des bei einem Rückfall bedrohten Rechtsgutes, das Verhalten im Vollzug, seine Lebensverhältnisse und die Wirkungen zu berücksichtigen, die von der Aussetzung für ihn zu erwarten sind (§ 57 Abs. 1 S. 2 StGB). Entscheidend für die Prognose nach § 57 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 StGB ist eine Abwägung zwischen den zu erwartenden Wirkungen des erlittenen Strafvollzugs für das künftige Leben der Verurteilten in Freiheit einerseits und den Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit andererseits. Isolierte Aussagen über die Wahrscheinlichkeit künftiger Straflosigkeit der Verurteilten sind wenig hilfreich. Vielmehr muss stets der Bezug zu den Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit im Auge behalten werden. Dies bedeutet, dass je nach der Schwere der Straftaten, die von dem Verurteilten nach Erlangung der Freiheit im Falle eines Bewährungsbruchs zu erwarten sind, unterschiedliche Anforderungen an das Maß der Wahrscheinlichkeit für ein künftiges strafloses Leben der Verurteilten zu stellen sind. Das Gewicht der bei einem Rückfall drohenden Rechtsgutsverletzung wird im Regelfall wiederum nach Art und Schwere der Straftaten zu beurteilen sein, die der Verurteilte bereits begangen hat (BGH, Beschluss vom 25. April 2003, StB 4/03, Rn 5 m. w. N.; OLG Hamm, Beschluss vom 10. März 2020, 3 Ws 67/20, Rn 8 m. w. N.; jeweils zitiert nach juris).
Verbüßt der Verurteilte – wie vorliegend – erstmals eine Freiheitsstrafe und gibt seine Führung während des Vollzugs keinen Anlass zu gewichtigen Beanstandungen, so kann allerdings im Regelfall davon ausgegangen werden, dass die Strafe ihre spezialpräventiven Wirkungen entfaltet hat und es verantwortbar ist, den Strafrest zur Bewährung auszusetzen (vgl. BGH, Beschluss vom 25. April 2003, StB 4/03, Rn 4, zitiert nach juris; Fischer, StGB, 71. Auflage, § 57 Rn. 14). Dieser Grundsatz gilt jedoch nicht uneingeschränkt, sondern erfährt wegen der vom Gesetzgeber in den Vordergrund gestellten Sicherheitsinteressen der Allgemeinheit eine Einschränkung, wenn besondere Umstände – in Form von gewichtigen negativen Prognoseindizien – vorliegen (vgl. OLG Zweibrücken, Beschluss vom 18. Februar 2022 – 1 Ws 19/22 –, Rn. 5, KG Berlin, Beschluss vom 26. Mai 2021 – 5 Ws 88/21 –, Rn. 15, 16 m. w.N., zitiert nach juris). So kann eine Strafrestaussetzung trotz Erstverbüßung im Einzelfall ausscheiden, wenn die Umstände der Tatbegehung sowie das Umfeld des Verurteilten auf dessen nachhaltige Verstrickung in ein kriminogenes Milieu schließen lassen (beispielsweise beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln oder bei Taten der organisierten Kriminalität), in seiner Persönlichkeitsstruktur und seinen Lebensverhältnissen nach wie vor ernstzunehmende Rückfallrisiken angelegt sind (beispielsweise bei der wiederholten Begehung einschlägiger Straftaten, bei einer gravierenden, für wiederholte, erhebliche Straftaten ursächlichen Suchtproblematik oder mehrfachem Bewährungsversagen in Verbindung mit weiteren Umständen) oder wenn bei einem Rückfall Rechtsgüter von besonderem Gewicht bedroht sind, etwa bei schweren Gewalttaten oder bei Delikten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (KG a. a. O.).
Die Vermutung, dass der erstmalige Strafvollzug bei dem Verurteilten einen deutlichen Eindruck hinterlassen hat und seine Entlassung verantwortet werden kann, ist in der Gesamtschau aller zu berücksichtigenden Umstände nicht entkräftet. Ihre gegenteilige Einschätzung, trotz des Status des Verurteilten als Erstverbüßer, seiner Mitarbeitsbereitschaft und seines beanstandungslosen Verhaltens im Vollzug sei der Strafzweck sei noch nicht erfüllt, hat die Leiterin der Jugendanstalt Raßnitz in ihrer Stellungnahme vom 14. März 2024 nicht weiter begründet. Die Vermutung ist insbesondere nicht schon allein deswegen widerlegt, weil der Verurteilte Bewährungsversager ist (siehe BGH a. a. O.; Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 1. Juni 2023 – 2 Ws 62/23 (S) –, Rn. 7; OLG Bamberg, Beschluss vom 20. Januar 2021 – 1 Ws 32/21 –, Rn. 11; OLG Karlsruhe, Beschluss vom 21. November 2007 – 2 Ws 308/07 –, Rn. 11; jeweils zitiert nach juris). Insoweit ist zu berücksichtigen, dass der Verurteilte ausschließlich die der Ausgangsverurteilung zugrundeliegende Tat innerhalb der Bewährungszeit nach der Verurteilung zu einer bedingten Freiheitsstrafe durch das Amtsgericht Wittenberg vom 10. November 2020 begangen hat. Alle weiteren Straftaten, aufgrund derer er verurteilt wurde, lagen vor dieser Verurteilung. Auch stand er zum Zeitpunkt der der Ausgangsverurteilung zugrundeliegenden Tat entgegen der Annahme der Generalstaatsanwaltschaft nicht zweifach unter Bewährung, sondern lediglich aufgrund des genannten Urteils des Amtsgericht Wittenberg vom 10. November 2020. Auch wenn der Verurteilte wegen einer schwerwiegenden Tat unter Bewährung stand, lässt sich doch aus dem – auch nicht mit einer hohen Rückfallgeschwindigkeit verbundenen – einmaligen Bewährungsbruch mit einer nicht einschlägigen Straftat keine besondere Unbelehrbarkeit des Verurteilten ableiten, die ausnahmsweise zu der Annahme berechtigt, dass die erstmalige Verbüßung von Strafhaft den Verurteilten nicht ausreichend beeindruckt hätte. Dies gilt nach Ansicht des Senats hier auch unter Berücksichtigung des Umstands, dass der Verurteilte sich in dem Verfahren, das zu dem Urteil des Amtsgerichts Wittenberg vom 10. November 2020 geführt hat, von Oktober 2019 bis Februar 2020 für etwa drei Monate in Untersuchungshaft befunden hat. Denn diese erfolgte noch deutlich vor der Verurteilung durch das Amtsgericht Wittenberg vom 10. November 2020 und mehr als anderthalb Jahre vor Begehung der nicht einschlägigen Anlasstat und kann im Hinblick auf die nachhaltige und spezialpräventive Wirkung auf den Gefangenen auch nicht mit Strafhaft verglichen werden (vgl. Brandenburgisches Oberlandesgericht, Beschluss vom 1. Juni 2023 – 2 Ws 62/23 (S) –, Rn. 5, zitiert nach juris). Zudem ist zu berücksichtigen, dass der Verurteilte nach einer Haftentlassung voraussichtlich keine Position als Geschäftsführer oder in ähnlicher Verantwortung innehaben wird, die zuvor zu der dem Freiheitsentzug zugrundeliegenden Tat geführt hat. Vielmehr strebt er ausweislich der bei der mündlichen Anhörung vorgelegten Bescheinigung eine Anstellung als Servicetechniker an. Berücksichtigt man ferner, dass der Verurteilte nach der Haftentlassung in ein stabiles soziales Umfeld zurückkehrt und bei einem Rückfall in Ansehung der Anlasstat kein besonders schwerwiegendes Rechtsgut bedroht ist, lässt sich die vorzeitige Entlassung des Verurteilten auch unter Berücksichtigung des Sicherheitsinteresses der Allgemeinheit verantworten.“
Nichts weltbewegend Neues, aber immerhin…. 🙂 .