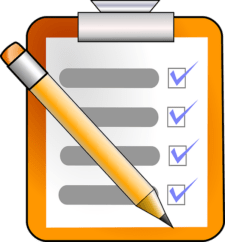Im „Kessel Buntes“ heute dann zwei vereinsrechtliche Entscheidungen, also zu einem meiner „Vorkinder“ 🙂 .
Zunächst hier der OLG Köln, Beschl. v. 03.05.2023 – 2 Wx 56/23, schon etwas älter, aber sicherlich immer mal wieder von Bedeutung. Folgender Sachverhalt:
Im Vereinsregister eines Vereins ist am 28.12.2004 eingetragen worden, dass ein Vereinsmitglied als Vorstandsvorsitzender aus dem Vorstand ausgeschieden ist. Aus dem chronologischen Auszug des Vereinsregisters, der auch die gelöschten Daten enthält, ist die ehemalige Vorstandstätigkeit des – unter Nennung seines vollständigen Namens und Geburtsdatums eingetragenen – Beteiligten ersichtlich. Es wird nun die Löschung der Angabe des Geburtsdatums verlangt und außerdem, dass die Dauer der Vorstandstätigkeit nicht mehr voraussetzungslos über das Internet verfügbar gemacht werden. Der Antrag wird zurückgewiesen. Dagegen dann die Beschwerde an das OLG Köln. Die hatte keinen Erfolg:
„In der Sache hat die Beschwerde indes keinen Erfolg. Das Registergericht hat die beantragte Löschung der persönlichen Daten des Beteiligten im Vereinsregister, insbesondere seines Geburtsdatums, zu Recht abgelehnt. Auch der mit der Beschwerde gestellte Antrag auf Löschung seiner direkt abrufbaren Daten im Vereinsregister und sein Hilfsantrag, die Verarbeitung seiner persönlichen Daten dahingehend einzuschränken, dass hierüber nur noch nach Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses im Einzelfall Auskunft erteilt werde, haben keinen Erfolg.
Für das Begehren des Beteiligten fehlt es an einer Rechtsgrundlage. Ein Löschungsanspruch zugunsten des Beteiligten ergibt sich nicht aus Art. 17 Abs. 1, Abs. 2 DSGVO. Denn diese Bestimmungen gelten gemäß Art. 17 Abs. 3 lit. b) DSGVO nicht, soweit die Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, notwendig ist. Hier ergibt sich eine solche Verpflichtung aus § 387 Abs. 2 FamFG in Verbindung mit §§ 3, 11 VRV. Soweit sich der Beteiligte auf Art. 18, 21 DSGVO stützt, dringt er damit nicht durch. Ein Widerspruchsrecht gem. Art 21 Abs. 1 DSGVO steht dem Beteiligten gem. § 79a Abs. 3 BGB nicht zu. Dementsprechend ist auch Art. 18 Abs. 1 lit. b) DSGVO nicht einschlägig, weil diese Bestimmung das Bestehen eines Widerspruchsrechts gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO voraussetzt, das hier aber aus vorgenannten Gründen nicht besteht (für den Fall eines im Handelsregister eingetragenen Geschäftsführers einer GmbH ebenso: OLG Celle, Beschluss vom 24.02.2023 – 9 W 16/23). Auch § 395 FamFG ist hier nicht einschlägig. Denn die Aufnahme des Geburtsdatums und Wohnorts des Beteiligten in das Vereinsregister war im Hinblick auf § 387 Abs. 2 FamFG in Verbindung mit § 3 S. 3 Nr. 3 VRV nicht unzulässig im Sinne von § 395 FamFG. Die Löschung durch bloße „Rötung“ entspricht § 11 VRV.
Die Eintragung des Geburtsdatums (und des ehemaligen Wohnortes) des Beteiligten in das Vereinsregister und die Löschung des Beteiligten durch bloße „Rötung“ nach seinem Ausscheiden als Vorstandsvorsitzender verstößt nicht gegen europäisches Recht. Der Einwand des Beteiligten, dass europäisches Recht vorrangig sei und das nationale Recht verdränge, verhilft seiner Beschwerde nicht zum Erfolg, weil das europäische Recht in der DSGVO entsprechende Ausnahmen vorsieht und dem nationalen Gesetzgeber Regelungsinhalte belassen hat. Nach der Gesetzesbegründung zu § 79a BGB gilt für Eintragungen im Vereinsregister der Grundsatz der Erhaltung der Eintragung, welche den Kern des materiell-rechtlichen Publizitätsprinzips bildet. Diese wird unter anderem dadurch geschützt, dass Eintragungen gem. § 383Abs. 3FamFG nicht mit der Beschwerde anfechtbar sind. Es würde dem Kern des Grundsatzes der Publizitätswirkung widersprechen, sollten Eintragungen über einen längeren Zeitraum nicht einsehbar sein. Die Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Rechts- und Wirtschaftsverkehrs durch uneingeschränkt einsehbare Register ist im allgemeinen öffentlichen Interesse. Ein Widerspruch der betroffenen Person gem. Art. 21 DSGVO, der zu einer Einschränkung der Verarbeitung von Registerdaten führen könnte, wird deshalb durch § 79a Abs. 3 BGB auf der Grundlage des Art. 23 Abs. 1 lit. e) DSGVO ausgeschlossen. Auch insoweit bleibt es bei den registerrechtlichen Vorschriften über die Löschung und Berichtigung (BT-Drs. 19/4671, 111 f.; vgl. auch BeckOK-BGB/Schöpflin, 65. Ed., Stand 01.02.2023, § 79a Rn. 5). Ein Recht der betroffenen Person auf Löschung von Daten, die im Vereinsregister oder in den Registerakten gespeichert sind, kann nach Art. 17 Abs. 1 DSGVO gegenüber dem registerführenden Gericht nicht geltend gemacht werden, da die Daten im Register und den Registerakten zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse gespeichert werden, sodass nach Art. 17 Abs. 3 lit. b) DSGVO ein Recht auf Löschung nicht besteht (BT-Drs. 19/4671, 111 f.; vgl. auch BeckOK-BGB/Schöpflin, 65. Ed., Stand 01.02.2023, § 79a Rn. 7). Eine Beschränkung des Rechts der betroffenen Person auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 Abs. 1 DSGVO ist nicht erforderlich. Die Verarbeitung personenbezogener Daten im Vereinsregister oder den Registerakten ist, auch wenn das Recht geltend gemacht wird, nach Art. 18 Abs. 2 DSGVO weiterhin uneingeschränkt möglich. Das Führen des Vereinsregisters ist ein wichtiges öffentliches Interesse (vgl. auch Erwägungsgrund 73 der DSGVO), sodass die Datenverarbeitung nicht eingeschränkt werden muss (BT-Drs. 19/4671, 111 f.; vgl. auch BeckOK-BGB/Schöpflin, 65. Ed., Stand 01.02.2023, § 79a Rn. 8).
Soweit der Beteiligte noch vorträgt, dass seine Daten nicht mehr erforderlich seien, weil er schon im Jahr 2004 aus dem Amt des Vorstandsvorsitzenden ausgeschieden sei, verhilft auch dies seiner Beschwerde nicht zum Erfolg. Es ist gerade Folge der uneingeschränkten Publizitätswirkung des Vereinsregisters, dass auch überholte Eintragungen aus dem Register ersichtlich sind, dieser Umstand vielmehr durch „Rötung“ gekennzeichnet wird. Hierfür spricht, dass aus dem Register nicht nur die jeweils aktuelle Situation, z.B. bezüglich der Vertretungsbefugnisse, ersichtlich sein muss, sondern auch die früher bestehenden Vertretungsbefugnisse, weil diese im Hinblick auf die Wirksamkeit von Eintragungen, Satzungsänderungen oder abgeschlossenen Rechtsgeschäften auch deutlich später noch von erheblicher Bedeutung sein können.“