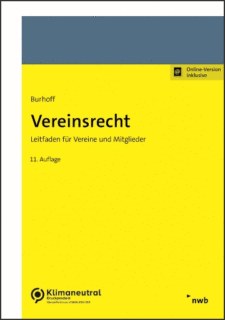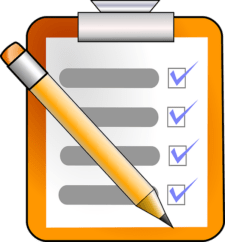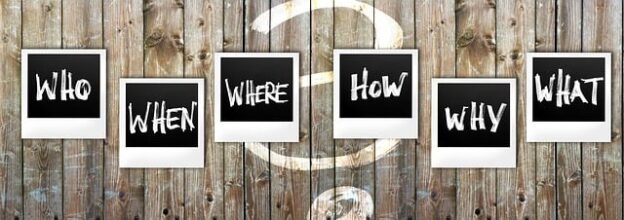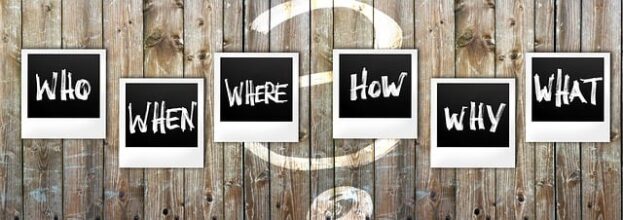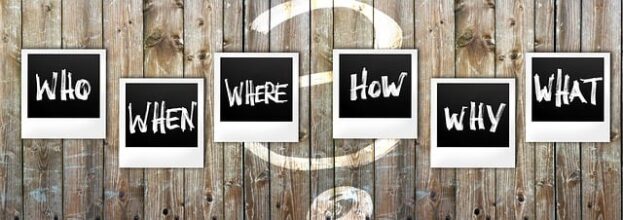
Bild von Gerd Altmann auf Pixabay
Bei der zweiten vorpfingstlichen Entscheidung im Kessel-Buntes handelt es sich um das AG Düsseldorf, Urt. v. 07.03.2023 – 40 C 226/22.
In dem Urteil hat das AG die vom Kläger begehrte Löschung von Daten in der sog. HIS-Datei abgelehnt. Das Fahrzeug, um das es geht, war anlässlich eines Verkehrsunfalls am 29.07.2020 beschädigt worden. Die Beklagte hatte seinerzeit als eintrittspflichtige Haftpflichtversicherung den Schaden bearbeitet und reguliert. Nach der Abrechnung eines wirtschaftlichen Totalschadens auf fiktiver Basis durch den damaligen Eigentümer nach dem Verkehrsunfall vom 29.07.2020 gab die Beklagte am 18.08.2020 folgende Informationen weiter: „Hersteller: MERCEDES-BENZ, Typ GI 350 CDI 4MATIC, Fahrzeugart PKW, Erstzulassung 01.06.2016″. Außerdem wurde gemeldet, dass der Meldegrund eines Totalschadens vorlag und das Datum des Schadens wurde mitgeteilt.
Der Vorbesitzer des Fahrzeugs ließ eine Reparatur durchführen. Dies teilte er der Beklagten mit.
Der Kläger, ein durch die IHK öffentlich bestellter und vereidigter KFZ-Sachverständiger, führte eine Besichtigung am 24.08.2021 selbst durch. Er erstellte daraufhin eine Reparaturbestätigung nebst Lichtbildnachweisen. Diese sandte er der Beklagten zu und bat um Löschung der personenbezogenen Daten. Dies lehnte die Beklagte, auch nach anwaltlicher Aufforderung ab.
Der Kläger hat behauptet, er sei seit 24.04.2021 Eigentümer des Fahrzeugs. Das Fahrzeug sei vollständig und fachgerecht repariert. Er verlangt die Löschung der Daten.
Das AG hat die Klage abgewiesen:
„Der Kläger hat keinen Anspruch auf Löschung der gemeldeten Daten nach Art. 17 Abs. 1 a) DSGVO.
Gern. Art. 17 Abs. 1 a) DSGVO sind personenbezogene Daten zu löschen, sobald diese nicht mehr für die Zwecke notwendig sind, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet worden sind.
Dies ist namentlich dort der Fall, wo ein der Datenerhebung bzw. -speicherung zu Grunde liegendes Prüfverfahren hinsichtlich der aufgenommenen Daten endgültig abgeschlossen worden ist (EuGH, NJW 2018, 767). Die Löschung als solche hat dabei der „Verantwortliche“ im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DSGVO vorzunehmen, wobei allerdings im Falle der Veranlassung der (fortlaufenden) Speicherung bei einem Verantwortlichen durch einen Dritten, dieser Dritte zur Einwirkung auf den Verantwortlichen im Rahmen eines Unterlassungsanspruches verpflichtet ist.
Diese Voraussetzungen sind hier nicht erfüllt.
Nach Art. 17 Abs. la der DSGVO hat die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern die Speicherung und Verarbeitung nicht mehr für die Zwecke, für die sie erhoben wurden notwendig sind.
Zwar dürfte es sich bei den gemeldeten Daten um personenbezogene Daten im Sinne der Verordnung handeln, da über eine einfache Abfrage zu der FIN ein Zusammenhang mit dem Kläger als Person hergestellt werden kann.
Es besteht hier jedoch kein Löschungsanspruch, weil hier keine schutzwürdigen Belange des Klägers beeinträchtigt werden (vergl. OLG Hamm Urt. v. 14.02.2018 11 U 126/17).
Ob das Fahrzeug vollständig und fachgerecht repariert wurde, ist streitig.
Auch eine Beweisaufnahme zu der Frage, ob das Fahrzeug fachgerecht und umfassend repariert wurde, brauchte das Gericht nicht durchzuführen. Zum einen würde es sich um einen unzulässigen Ausforschungsbeweis handeln, da es an jeglichem Vortrag fehlt, welche konkreten Schäden vorhanden waren und welche Reparaturschritte erfolgt sein sollen.
Die von dem Kläger selbst ausgestellte Reparaturbescheinigung sowie eine Hauptuntersuchungsbescheinigung oder eine Garantie haben jedenfalls keinen Beweiswert für die Frage, ob tatsächliche eine umfassende Reparatur aller Schäden durchgeführt wurde. Es bleibt völlig unklar welche Schäden vorlagen und welche Reparaturmaßnahmen erfolgten.
Auch eine Güterabwägung nach Art. 6 der DSGVO ergibt, dass ein berechtigtes Interesse des Versicherers an den entsprechenden Daten besteht.
Auch bei einer fachgerechten und umfassenden Reparatur bleibt der Umstand erhalten, dass das Fahrzeug in der Vergangenheit einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitten hatte, was im Verkaufsfall eine aufklärungspflichtige Information darstellt und in der Regel zu einem dauerhaft verbleibenden Minderwert des Fahrzeugs führt, insbesondere wenn keine konkreten Nachweise über eine Reparatur vorliegen. Um eine solche Bewertung vornehmen zu können, bleibt ein Interesse an der Speicherung der Daten in HIS vorhanden, unabhängig von der Qualität der durchgeführten Reparatur.
Zutreffend führt die Beklagtenseite aus, dass die Einmeldung auch deshalb gerechtfertigt ist, um die Höhe eines bei einem weiteren Verkehrsunfall entstandenen Schadens zutreffend beurteilen und die Abrechnung eines zu hohen Schadensersatzanspruchs zu Lasten der Versichertengemeinschaft verhindern zu können. Es geht also nicht nur um Fälle einer gezielten Täuschung, sondern es sind auch Konstellationen denkbar, bei denen der Anspruchssteller selber keine Kenntnis von einem Vorschaden hat oder den Umfang des Schadens bzw. die Qualität der durchgeführten Reparaturmaßnahmen selber nicht richtig beurteilt – auch in diesen Fällen muss zugunsten der Versichertengemeinschaft eine Prüfung ermöglicht werden, ob und in welchem Umfang ein neuer Schaden eingetreten ist und welche Reparaturkosten zu seiner Beseitigung erforderlich sind. Auch die Höhe eines Wiederbeschaffungswertes wird dadurch beeinflusst.
Demgegenüber ist die im Rahmen der Gesamtgüterabwägung die Beeinträchtigung des Klägers durch Speicherung der Daten als geringfügig einzustufen.“