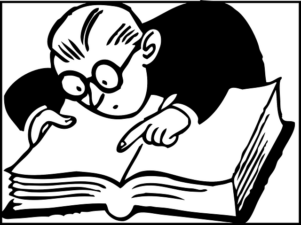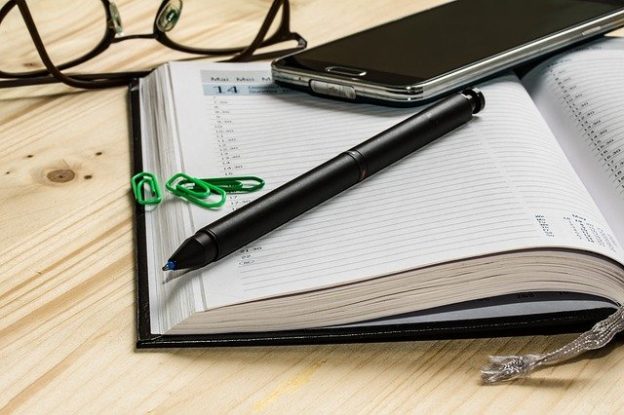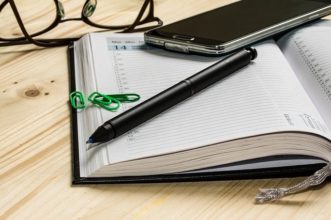Und dann vor Weihnachten doch noch etwas zum Kopfschütteln, und zwar:
Anfang des Monats hatte ich über den LG Braunschweig, Beschl. v. 27.11.2024 – 2b Qs 342/24 – und den LG Braunschweig, Beschl. v. 27.11.2024 – 2b Qs 346/24 – berichtet (vgl. hier: OWi II: Terminsverlegungsanträge des Verteidigers, oder: Ablehnung nur mit konkreten Gründen).
In beiden Entscheidungen ging es um vom AG Helmstedt zu Unrecht abgelehnte Terminsverlegungsanträge des Verteidigers, der gegen die Ablehnungen jeweils Beschwerde eingelegt hatte. Das AG hatte dann kurzerhand die Beschwerde dem LG vorgelegt. Eine Abhilfeentscheidung war nicht ergangen. Das LG hatte dennoch nicht zurückverwiesen, sondern aufgehoben und dem AG mit recht deutlichen Worten mitgeteilt, was es von den Ablehnungen in der Sache hält, nämlich nichts.
Wer nun gedacht hatte, dass es damit gut ist/war, der hat sich geirrt. Denn das AG Helmstedt macht folgendes – ich nehme jetzt mal den Sachverhalt aus dem (neuen) LG Braunschweig, Beschl. 16.12.2024 – 2b Qs 371/24 -, der aus dem LG Braunschweig, Beschl. 16.12.2024 – 2b Qs 372/24 – ist identisch: Das LG hatte mit Beschluss vom 27.11.2024 die Entscheidung des Amtsgerichts, die für den 02.12.2024 anberaumte Hauptverhandlung nicht zu verlegen, aufgehoben. Mit Aktenrückübersendung hatte die Vorsitzende das AG darauf hingewiesen, dass in Zukunft eine förmliche Abhilfeentscheidung zu treffen ist und nicht einfach die Akten übersandt werden dürften. Das AG Helmstedt beraumte daraufhin einen neuen Termin für den 23.01.2025 an. Der Termin war mit dem Verteidiger vorher wieder nicht abgestimmt. Mit Schriftsatz vom 03.12.2024 beantragte der Verteidiger erneut Terminsverlegung und bot den 30.01.2025 und 06.02.2025 als neue Verhandlungstermine an. Mit fast wortgleichem Schreiben wie vom 07.11.2024 – das war das frühere Verfahren – lehnte das AG AG Helmstedt die Terminsverlegung wieder ab, wogegen sich dann der Verteidiger erneut mit der Beschwerde wandte.
Und jetzt hat das LG – in beiden Verfahren – gesagt: Genug ist genug und hat aufgehoben und zurückverwiesen. Hier die Gründe aus LG Braunschweig, Beschl. 16.12.2024 – 2b Qs 371/24 -, die aus LG Braunschweig, Beschl. 16.12.2024 – 2b Qs 372/24 – sind gleich:
„An einer Entscheidung über die Beschwerde sieht sich die Kammer mangels Zuständigkeit gehindert; die Sache ist nicht entscheidungsreif, weil die zunächst erforderliche Abhilfeentscheidung (§ 306 Abs. 2 StPO) noch nicht ergangen ist (vgl. BGH, NStZ 1992, 507; BGH, Beschluss vom 27. Januar 2022 – 6 StR 1/22 –, juris).
Fehlt eine (Nicht-)Abhilfeentscheidung hat das Beschwerdegericht unter Berücksichtigung seiner Pflicht zur schnellen und wirtschaftlichen Erledigung der Beschwerde darüber zu befinden, ob es selbst entscheiden oder dem Erstrichter Gelegenheit geben will, die unterbliebene Entscheidung über die Abhilfe nachzuholen (OLG Hamm, Beschluss vom 18. Dezember 2002 – 2 Ws 475/02 = VRS 104, 372, 373; vom 05. Februar 2009 – 2 Ws 16/2009 -; OLG Hamm, Beschluss vom 17. Februar 2009 – 2 Ws 34 – 38/09 –, juris, Holger Matt, in: Löwe-Rosenberg, StPO, § 306 Rn. 21 – jeweils mit weiteren Nachweisen). Teilweise wird in der Literatur die Ansicht vertreten, eine Zuleitung an das Erstgericht zur Nachholung der (Nicht-)Abhilfeentscheidung komme stets in Betracht, wobei es sich nicht um eine die Aufhebung der erstgerichtlichen Entscheidung voraussetzende „Zurückverweisung“ handele (Engelhardt, in: Karlsruher Kommentar, StPO, § 306 Rn. 19 – ohne weitere Begründung). Nach anderer Meinung ist eine Zurückverweisung ausnahmsweise nur dann angezeigt, wenn das Verfahren dadurch beschleunigt wird, weil die tatsächliche Richtigkeit des Beschwerdevorbringens vom sachnäheren Erstrichter leichter und schneller festgestellt werden kann und zu erwarten ist, dass dieser seine Entscheidung aufgrund dessen selbst korrigiert (Holger Matt, in: Löwe-Rosenberg, StPO, § 306 Rn. 21) und das Beschwerdegericht andernfalls an einer eigenen Sachentscheidung im Sinne des § 309 Abs. 2 StPO gehindert wäre (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 306 Rn. 10). Denn die Nichtabhilfe ist keine Verfahrensvoraussetzung für die Entscheidung des Beschwerdegerichts (OLG Hamm, Beschluss vom 18. Dezember 2002 – 2 Ws 475/02 = VRS 104, 372, 374 mit zahlreichen weiteren Nachweisen; vom 05. Februar 2009 – 2 Ws 16/2009 -; OLG Hamm, Beschluss vom 17. Februar 2009 – 2 Ws 34 – 38/09 –, juris. Holger Matt, in: Löwe-Rosenberg, StPO, § 306 Rn. 21; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, § 306 Rn. 10). Eine eigene Entscheidung des Beschwerdegerichts entsprechend § 309 Abs. 2 StPO ist danach bei offensichtlicher Erfolglosigkeit der Beschwerde geboten, bei der ohne längere Prüfung erkennbar ist, dass das Beschwerdevorbringen die Beschwerde nicht zu begründen vermag (OLG Hamm, Beschluss vom 18. Dezember 2002 – 2 Ws 475/02 = VRS 104, 372, 374; vom 05. Februar 2009 – 2 Ws 16/2009). Ein Streitentscheid ist hier nicht erforderlich. Ein Fall der sofortigen Entscheidung der Kammer wegen unzumutbarer Verfahrensverzögerung oder der offensichtlichen Erfolglosigkeit der Beschwerde liegt hier gerade nicht vor. Die Beschwerde könnte nach Auffassung der Kammer durchaus begründet sein, weil die Ablehnung des erneuten Terminsverlegungsantrages erneut ermessensfehlerhaft sein könnte.
Wird mit der Beschwerde erhebliches neues Vorbringen verbunden, das einer Klärung bedarf, weil es sich um ein ernstzunehmendes neues und vom Erstgericht ohne sonderliche Mühe überprüfbares Vorbringen handelt, das im Falle seiner Richtigkeit die tatsächlichen Grundlagen der angefochtenen Entscheidung in Frage stellen würde, dann ist das Erstgericht zu einer Prüfung und zur Begründung seiner Entscheidung verpflichtet (OLG München, NJW 1973, 1143). Das Amtsgericht hat sich gerade nicht mit der Beschwerdebegründung vom 06.12.2024 auseinandergesetzt. Vielmehr erfolgte die Ablehnung der erneuten Terminsverlegung wieder mit fast wortgleichem Schreiben wie zuvor und wie auch im Parallelverfahren unter Beteiligung des gleichen Verteidigers. Eine Ausübung des Ermessens ist darin nicht zu erkennen.
Die Notwendigkeit einer auf das Vorbringen vom 06.12.2024 bezogenen Abhilfeentscheidung entfällt auch nicht deshalb, weil das Amtsgericht in dieser Sache zuvor bereits einmal nicht abgeholfen hat. Diese konkludente Abhilfeentscheidung reicht im Hinblick auf das neue Beschwerdevorbringen nicht mehr aus. Das Abhilfeverfahren soll dem Erstrichter die Gelegenheit zur Korrektur seiner Entscheidung geben, um dem Beschwerdegericht ggf. eine Befassung mit der Sache zu ersparen (BGH MDR 1992, 593¬594; OLG München NJW 1973, 1143). Dieser Aufgabe kann es nur gerecht werden, wenn sämtliches vor Weiterleitung der Akten an das Beschwerdegericht aktenkundige Vorbringen des Beschwerdeführers berücksichtigt wird (BGH MDR 1992, 593-594). So kann das Beschwerdegericht nicht nachvollziehen, warum die angebotenen Ersatztermine am 30.01.2025 und 06.02.2025 für das Amtsgericht nicht in Betracht kommen, obwohl beide Termine einen Donnerstag betreffen, so wie es der Vorgabe des Amtsgerichts entsprach. Dass bei einer Verlegung auf einen der angebotenen Ersatztermine eine nennenswerte Verfahrensverzögerung eintritt, die gegen das Recht nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 MRK verstößt, ist für die Kammer ebenfalls nicht erkennbar. Eine auf den konkreten Einzelfall bezogene Abhilfeentscheidung ist daher unerlässlich und könnte mutmaßlich der Beschwerde auch zum Erfolg verhelfen, ohne dass es einer Entscheidung der Kammer bedarf.“
Wie gesagt: Kopfschütteln, und zwar mehr als „gelinde“. Denn man fragt sich, was das Verhalten des AG soll? Die Vorsitzende weist auf die Notwendigkeit einer Abhilfeentscheidung hin und die Kammer schreibt in den Gründen der vorhergehenden Entscheidungen mehr als deutlich, wie mit Terminsverlegungsanträgen umzugehen ist. Und was passiert: Das AG bescheidet die neuen Verlegungsanträge wieder, ohne die Vorgaben des LG zu beachten, und legt dann wieder ohne Abhilfe vor. Was wird damit bezweckt: Will das Gericht den Verteidiger ärgern oder gar die Beschwerdekammer oder liest man einfach nicht, was aus der Beschwerde zurückkommt, nach dem Motto: Was schert mich die Beschwerdekammer. Das AG sollte mal überlegen, was an unnützer Zeit und Arbeit sowohl beim Beschwerdegericht als auch beim Verteidiger damit vergeudet wird. Aber das interessiert wahrscheinlich auch nicht. Für solche Entscheidungen müsste es „Strafzahlungen“ geben 🙂 🙂 .