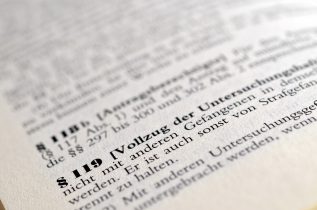Und dann Start in die 4. KW, und zwar mit zwei Entscheidungen zu Ermittlungsmaßnahmen, also mal wieder StPO.
Ich beginne mit dem LG Essen, Beschl. v. 08.01.2024 – 64 Qs 26/23, der sich zur Anordnung einer Maßnahme nach § 81g StPO äußert. Dem Beschuldigten, einem Jugendlichen, wird vorgworfen, zusammen mit vier Mittätern, bei einem „Drogenankauf“ den Verkäufer überfallen une beraubt zu haben. Deswegen ist ein Verfahren wegen schweren Raubes gegen den Beschuldigten anhängig. In dem Verfahren ist vom AG auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Entnahme von Körperzellen bei dem Beschuldigten gemäß § 81g StPO sowie die Untersuchung molekulargenetischen Materials bei dem Beschuldigten gemäß § 81g StPO für zukünftige Identitätsfeststellungen angeordnet worden. Dagegen richtet sich die Beschwerde des Beschuldigten, die Erfolg hatte.
Das LG stellt zunächst fest, dass der Beschuldigte vor der Anordnung nicht ausreichend angehört worden ist. Das hat das LG aber im Beschwerdeverfahren nachgeholt und es entscheidet dann in der Sache:
„3. Die Voraussetzungen für die Anordnung der beantragten Maßnahmen liegen jedoch nicht vor.
Die Entnahme und die Untersuchung der Körperzellen sind grundsätzlich auch im anhängigen Strafverfahren zulässig. Zum Schutz des Betroffenen stellt § 81 g StPO strengere Voraussetzungen auf, die unterlaufen würden, ließe man die Einbindung in eine auf der Grundlage des § 81b Alt. 2 StPO angeordnete erkennungsdienstliche Behandlung zu. Auf den Verdachtsgrad kommt es nicht an, so dass ein Anfangsverdacht ausreicht. Die Anordnung einer DNA-Identitätsfeststellung setzt damit lediglich einen einfachen Tatverdacht (Anfangsverdacht) zum Zeitpunkt der Anordnung der Entnahme und der Untersuchungsanordnung nach § 81 f StPO voraus (vgl. BeckOK StPO/Goers, 49. Ed. 1.10.2023, StPO § 81g Rn. 1 m. w. N.). Weil der Gesetzeswortlaut von künftigen Strafverfahren und nicht von künftigen Straftaten spricht, sind die Maßnahmen auch dann zulässig, wenn es um den Nachweis einer bereits begangenen, noch nicht aufgeklärten Straftat geht (vgl. BeckOK StPO/Goers, 49. Ed. 1.10.2023, StPO § 81g Rn. 6).
Der Beschuldigte ist zwar wegen einer Straftat von grundsätzlich erheblicher Bedeutung, vorliegend wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes nach §§ 249 Abs. 1, 250 Abs. 2 Nr. 1, 25 Abs. 2 StGB, angeklagt, denn dabei handelt es sich um eine Straftat, welche mindestens dem Bereich der mittleren Kriminalität zuzuordnen ist, den Rechtsfrieden empfindlich stören kann und welche geeignet ist, das Gefühl der Rechtssicherheit der Bevölkerung erheblich zu beeinträchtigen. Sollte der Beschuldigte eine ähnliche Tat – erneut – verüben, so könnten dabei grundsätzlich auch Körperzellen abgesondert werden (vgl. (BeckOK StPO/Goers, 49. Ed. 1.10.2023, StPO § 81g Rn. 3).
Jedoch besteht entgegen der weiteren Voraussetzung des § 81g Abs. 1 S. 1 StPO derzeit aufgrund der Ausführung der Tat und der Persönlichkeit des Beschuldigten kein Grund zur Annahme, dass gegen ihn künftig Strafverfahren wegen Straftaten von erheblicher Bedeutung zu führen sein werden. Denn die bisherige strafrechtliche Entwicklung des Beschuldigten spricht nicht dafür, dass er auch zukünftig gleich gelagerte Taten begehen wird.
Die Prognose künftiger Strafverfahren muss nach den Erkenntnissen bei der vorliegenden Straftat beurteilt werden. Insoweit sind konkretisierbare Anhaltspunkte für künftige gleichgelagerte Fälle erforderlich. Die künftigen Straftaten müssen Straftaten von erheblicher Bedeutung zum Gegenstand haben. Bei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden kann der Umstand, dass es sich um eine jugendtypische Verfehlung handelt, die Prognoseentscheidung maßgeblich beeinflussen. Auch wenn anzunehmen ist, dass sich der Angeklagte vom Drogenmilieu gelöst hat, kann dieser Umstand einer Anordnung entgegenstehen. Bei der Art oder Ausführung der Tat spielen die Tatschwere, die kriminelle Energie und das Nachtatverhalten eine Rolle.
Bei der Persönlichkeit des Beschuldigten sind seine kriminelle Karriere, seine Vorstrafen, sein soziales Umfeld, seine psychiatrischen Erkrankungen zu berücksichtigen. Bei den sonstigen Erkenntnissen sind kriminalistische oder kriminologisch anerkannte Erfahrungsgrundsätze heranzuziehen (vgl. BeckOK StPO/Goers, 49. Ed. 1.10.2023, StPO § 81g Rn. 6ff. m. w. N.)
Der Beschuldigte ist nicht vorbestraft. Darüber hinaus ist zu berücksichtigten, dass die ihm vorgeworfene Tat bereits länger als dreieinhalb Jahre zurückliegt und der Beschuldigte seitdem nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten ist.
Darüber hinaus handelt es sich bei der Tat um eine jugendtypische Verfehlung im Rahmen eines gruppendynamischen Prozesses, auch wenn die Kammer nicht verkennt, dass es sich um eine Straftat von jedenfalls mittlerer Kriminalität handelt.
Die Anordnung wäre vor dem Hintergrund der vorstehenden Ausführungen sowie unter Berücksichtigung dessen, dass der Beschuldigte bei der ihm vorgeworfenen Tat erst 19 Jahre alt war, auch unverhältnismäßig. Denn bei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden ist zu berücksichtigen, dass der Erziehungsgedanke des Jugendstrafrechts auf eine möglichst weitgehende soziale Integration abzielt. Deshalb ist unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit abzuwägen, ob durch die Speicherung des Identifizierungsmusters dem Jugendlichen eine Brandmarkung droht, die seiner sozialen Integration entgegenstehen kann (BeckOK StPO/Goers, 49. Ed. 1.10.2023, StPO § 81g Rn. 3). Eingriffe in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung sind bei Jugendlichen bzw. Heranwachsenden besonders restriktiv zu handhaben. So unterliegen jugendliche Straftäter im pubertären Alter – wie hier der zur Tatzeit 19-jährige Beschuldigte – anlässlich des natürlichen Selbstfindungsprozesses erheblichen Integrations- und Anpassungskonflikten, die sich vielfach in Verhaltensunsicherheit und gesteigertem Abweichungspotenzial ausdrücken. Die Verhaltensunsicherheit des Jugendlichen bzw. des Heranwachsenden kann dazu führen, dass er unfähig ist, Aggressionen und Bedürfnissen sozialadäquat Ausdruck zu verleihen, so dass die Ausübung körperlicher Gewalt oft zur einzigen Möglichkeit wird, diese zu artikulieren. Dies lässt sich dann als Mittel deuten, dem jugendlichen Streben nach Anerkennung und Selbstbehauptung – zumindest physisch – gerecht zu werden. Folglich werden beispielsweise Körperverletzungsdelikte als „jugendtypisch“ beschrieben. Das subjektive Bedürfnis nach Anbindung an eine Gruppe ist – im Vergleich zu Erwachsenen – bei Jugendlichen und Heranwachsenden gesteigert. In der Gruppe verringern sich Hemmungen gegenüber delinquentem Verhalten und Verantwortungsgefühl gegenüber Dritten, und die Begehung einer Straftat unterliegt vermehrt dem Einfluss gruppendynamischer Prozesse. Dies führt dazu, dass jugendliche Delinquenz typischerweise vorübergehend ist, die Mehrzahl jugendlicher Täter mithin lediglich einmal bzw. innerhalb einer bestimmten Lebensphase mehrfach bis zum effektiven Eingreifen der staatlichen Sanktionen strafrechtlich in Erscheinung tritt (vgl. LG Hannover, Beschluss vom 3. Juli 2014 – 31 Qs 3/14 –, Rn. 19, juris). Von einem solchen lediglich vorübergehend auftretenden delinquenten Verhalten ist nach Auffassung der Kammer im vorliegenden Fall des bisher noch nicht strafrechtlich in Erscheinung getretenen Beschuldigten aus den oben bereits genannten Gründen auszugehen.“