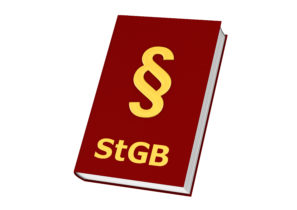Und dann noch einmal – der Beitrag war gestern schon – aufgrund eines technischen Versehens – online. 🙂
Als dritte StGB-Entscheidung dann noch der LG Verden, Beschl. v. 07.02.2022 – 4 Qs 101/21 – zur Strafbarkeit einer Äußerung über eine verstorbene Politikerin in einem Online-Kondolenzbuch als Beleidigung.
Die Staatsanwaltschaft hat beim AG den Erlass eines Strafbefehls beantragt. Vorgeworfen wird wird dem, am 17.05.2021 in N. das Andenken eines Verstorbenen verunglimpft zu haben, indem er auf dem – online-basierten – Trauerportal der Zeitung „XXX“ unter den Nachrufen der verstorbenen Sprecherin des Ortsverbandes R.-L. der Partei Bündnis 90/Die Grünen, B. N., einen Kommentar mit dem folgenden Inhalt verfasst haben soll: „WIEDER EIN GRÜNER WENIGER.HERRGOTT WIR DANKEN DIR.“.
Der Beschuldigte bestreitet den Tatvorwurf aus tatsächlichen Gründen. Das AG hat den Erlass des Strafbefehls aus rechtlichen Gründen abgelehnt. Dagegen die sofortige Beschwerde der StA, die Erfolg hatte:
2. Nach Maßgabe dieser Grundsätze ist vorliegend ein hinreichender Tatverdacht gegen den Beschuldigten wegen der in dem von der Staatsanwaltschaft Verden beantragten Strafbefehl bezeichneten Tat gegeben.
…..
Ausgangspunkt für die Prüfung, ob eine Äußerung eine Beleidigung i.S.v. § 185 StGB darstellt, ist die Ermittlung ihres objektiven Sinnes. Maßgeblich ist insofern weder wie der Erklärende seine Äußerung subjektiv verstanden haben wollte noch wie sie sein Kommunikationspartner tatsächlich verstanden hat (vgl. Valerius, in BeckOK/StGB, 46. Edition 2020, § 185 Rn. 21 m.w.N.), sondern der Sinn, den die Äußerung nach dem Verständnis eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums hat. Der tatsächliche Gehalt der Äußerung ist im Wege der Auslegung zu ermitteln. Es ist vom Wortlaut der Äußerung auszugehen, wobei dieser den Sinn der Äußerung nicht abschließend festlegt. Er wird vielmehr auch durch den sprachlichen Kontext, in dem die umstrittene Äußerung steht, und den Begleitumständen, unter denen sie fällt, bestimmt, soweit diese für die Empfänger erkennbar sind (BVerfG, Nichtannahmebeschluss der 1. Kammer des Ersten Senats vom 12.07.2005, Az.: 1 BvR 2097/02).
Bereits auf der einfachen Sinn- und Deutungsebene trägt der durch die schriftliche Erklärung „WIEDER EIN GRÜNER WENIGER.HERRGOTT WIR DANKEN DIR.“ zur Schau getragene Dank über den Tod eines Menschen ehrherabsetzenden Charakter. Jedoch verstößt nicht jede ehrherabsetzende Äußerung gegen § 185 StGB.
Der Ehrenschutz des Opfers einer Beleidigung steht nämlich regelmäßig im Widerstreit mit der Äußerungsfreiheit des Täters, die ihrerseits dem besonderen Schutz des Art. 5 Abs. 1 GG unterliegen kann. Zwar findet die dadurch geschützte Meinungsfreiheit seine Schranke schon nach Art. 5 Abs. 2 GG im Recht der persönlichen Ehre. Dies führt jedoch aufgrund der besonderen Bedeutung des Grundrechts aus Art. 5 Abs. 1 GG für eine pluralistische Demokratie nicht dazu, dass per se jede ehrangreifende Äußerung der Strafandrohung der §§ 185 ff. StGB unterliegt (OLG Celle, a.a.O., Rn. 33). Vielmehr müssen beide Rechtspositionen bei der Anwendung des einfachen Rechts in einen verhältnismäßigen Ausgleich gebracht werden. Dies erfolgt über eine Gesamtabwägung aller Umstände.
Dabei kommt es entscheidend darauf an, ob die Äußerung eine Tatsachenbehauptung oder die Kundgabe eines Werturteils, einer Meinung, darstellt. Während bei Tatsachenbehauptungen die objektive Beziehung zwischen der Äußerung und der Realität im Vordergrund steht, sind Meinungen durch die subjektive Beziehung des Einzelnen zum Inhalt seiner Aussage und durch die Elemente der Stellungnahme und des Dafürhaltens geprägt (BVerfG, Beschluss vom 13.04.1994, Az.: 1 BvR 23/94). Der Grundrechtsschutz des Art. 5 Abs. 1 GG bezieht sich grundsätzlich auf letzteres (vgl. OLG Celle, a.a.O., Rn. 33 – 34).
Bei der schriftlichen Erklärung „WIEDER EIN GRÜNER WENIGER.HERRGOTT WIR DANKEN DIR.“ handelt sich nicht um eine Tatsachenbehauptung, sondern um ein Werturteil. Zwar lässt sich die Äußerung auch als Behauptung über die – dem Beweis zugänglichen – Tatsache begreifen, es gäbe nunmehr ein Mitglied der Partei Bündnis 90/Die Grünen weniger. Eine solche Würdigung griffe indes zu kurz. Der Schwerpunkt der Äußerung ist – gemessen am Auslegungsmaßstab eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums – indes in der Missachtung, Geringschätzung bzw. Nichtachtung der Verstorbenen zu sehen. Dies ergibt sich bereits aus der Äußerung als solcher, die den Dank und somit die Freude über das Ableben eines Mitmenschen zum Ausdruck bringt. Verstärkt wird die zum Ausdruck kommende Missachtung, Geringschätzung und Nichtachtung noch durch den Kontext der Äußerung in einem online abrufbaren Kondolenzbuch der Verstorbenen. Durch die vorstehende Äußerung wird der Verstorbenen, derer sowohl im privaten, beruflichen und politischen Umfeld gedacht wird, der ethische, personale und soziale Geltungswert ganz oder teilweise abgesprochen, indem der Dank über ihr Ableben allein aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit bekundet wird. Hierdurch wird ihr grundsätzlich uneingeschränkter Achtungsanspruch verletzt.
Die Äußerung ist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit auch nicht durch die Wahrnehmung berechtigter Interessen gemäß § 193 StGB gerechtfertigt.
Werturteile unterfallen als Meinungsäußerungen dem Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 GG, ohne dass es darauf ankommt, ob die Äußerung begründet oder grundlos, emotional oder rational ist, als wertvoll oder wertlos, gefährlich oder harmlos eingeschätzt wird (BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 28.09.2015, Az.: 1 BvR 3217/14 Rn. 13). Auch eine polemische oder verletzende Formulierung entzieht die Äußerung nicht dem Schutz des Grundrechts (u.a. BVerfG, Beschluss der 3. Kammer des Ersten Senats vom 08.02.2017, Az.: 1 BvR 2973/14 Rn. 14). Wo der Grenzbereich von der Unhöflichkeit zur Beleidigung überschritten ist, ist nicht immer eindeutig (Regge/Pegel, in: MüKoStGB, 4. Aufl. 2021, § 185 Rn. 13).
Eine Formalbeleidigung, welche sich dadurch auszeichnet, dass sich die Kränkung bereits aus der Form der Äußerung ohne Rücksicht auf deren Inhalt ergibt, ist vorliegend nicht gegeben. Aber auch eine Schmähkritik liegt nach vorläufiger Würdigung der Sach- und Rechtslage nicht vor. Wegen seines die Meinungsfreiheit verdrängenden Effekts ist der Begriff der Schmähkritik von Verfassungs wegen eng zu verstehen. Schmähung im verfassungsrechtlichen Sinn ist gegeben, wenn eine Äußerung keinen irgendwie nachvollziehbaren Bezug mehr zu einer sachlichen Auseinandersetzung hat und es bei ihr im Grunde nur um das grundlose Verächtlichmachen der betroffenen Person als solcher geht. Es sind dies Fälle, in denen eine vorherige Auseinandersetzung erkennbar nur äußerlich zum Anlass genommen wird, um über andere Personen herzuziehen oder sie niederzumachen, etwa in Fällen der Privatfehde (vgl. BVerfG, Nichtannahmebeschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 19. Mai 2020, Az.: 1 BvR 2397/19 Rn.19 m.w.N.). Davon abzugrenzen sind Fälle, in denen die Äußerung, auch wenn sie gravierend ehrverletzend und damit unsachlich ist, letztlich als (überschießendes) Mittel zum Zweck der Kritik eines Sachverhaltes dient. Dann geht es dem Äußernden nicht allein darum, den Betroffenen als solchen zu diffamieren, sondern stellt sich die Äußerung als Teil einer anlassbezogenen Auseinandersetzung dar (BVerfG, ebd., Rn. 20). Die Wahl des Benutzernamens „DIE ANTIGRÜNEN“ und die Bezeichnung der Verstorbenen als „EIN GRÜNER“ lässt einen politischen Kontext zumindest erkennen, sodass eine Abwägung zwischen der Schwere der Persönlichkeitsbeeinträchtigung bzw. dem Pietätsempfinden der Angehörigen und die Menschenwürde der Verstorbenen einerseits und der Einbuße an Meinungsfreiheit durch das Verbot der Äußerung andererseits vorzunehmen ist. Das Ergebnis der Abwägung ist von den konkreten Umständen des Einzelfalls abhängig.
Das bei der Abwägung anzusetzende Gewicht der Meinungsfreiheit ist umso höher, je mehr die Äußerung darauf zielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten, und umso geringer, je mehr es hiervon unabhängig lediglich um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmungen gegen einzelne Personen geht (vgl. BVerfG, ebd., Rn. 29 m.w.N.). Allein die Wahl der Plattform, die online abrufbare Kondolenzseite einer Zeitung, zeigt, dass es dem Verfasser lediglich nachrangig – wenn überhaupt – um den öffentlichen Diskurs einer parteikritischen Äußerung geht. So lässt die Äußerung zwar einen Bezug zum politischen Kontext erkennen, sie setzt sich aber inhaltlich nicht argumentativ mit der Politik auseinander, sondern behandelt die Verstorbene aufgrund ihrer politischen Zugehörigkeit zu einer Partei als unterwertiges Wesen (vgl. BVerfG, Beschluss vom 04.02.2010, Az.: 1 BvR 369/04, Rn 31).
Wenn das Amtsgericht im Rahmen der zu treffenden Abwägung mit der grundrechtlich geschützten Meinungsfreiheit darauf abstellt, dass die Äußerung im virtuell-öffentlichen Raum einer Zeitung im unmittelbaren Zusammenhang zu einer öffentlichen Erklärung eines politischen Verbands vorgebracht wurde und die vom Verfasser verfolgte Zielrichtung darüber hinaus auch durch die Wahl seines Benutzernamens „DIE ANTIGRÜNEN“ deutlich gemacht worden sei, stellt dies eine Verkürzung der nach Aktenlage vorliegenden Tatsachen dar. Die Homepage XXX enthält ausweislich des Screenshots vom heutigen Tage bereits seit dem 15.05.2021 insgesamt drei Traueranzeigen. Die oberste Traueranzeige wurde gestellt von „T., S. und Su.“. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei „T.“ um den Witwer der Verstorbenen und Antragsteller T. F. N. handelt. Bei der mittleren Traueranzeige handelt es sich um diejenige des R.-L. Ortsverbands der Partei Bündnis 90/Die Grünen. Bei der untersten Traueranzeige handelt es sich um eine der Schulgemeinschaft der Grundschule M., an der die Verstorbene seit 2012 gearbeitet hatte. Der Kontext des hinterlassenen Kommentars ist hiernach keineswegs allein im Politischen zu suchen. Selbst wenn dies so wäre, änderte es nichts an der Beurteilung seiner Strafbarkeit. Im Gegenteil:
In der zu treffenden Abwägung sind die Besonderheiten digitaler Kommunikation zu berücksichtigen (vgl. hierzu auch die Beschlüsse des BVerfG vom 19.05.2020 zu den Az.:1 BvR 2397/19, 1 BvR 1094/19 und 1 BvR 362/18). Mit Blick auf Form und Begleitumstände einer Äußerung kann insbesondere erheblich sein, ob sie unvermittelt in einer hitzigen Situation oder im Gegenteil mit längerem Vorbedacht gefallen ist. Denn für die Freiheit der Meinungsäußerung wäre es besonders abträglich, wenn vor einer mündlichen Äußerung jedes Wort auf die Waagschale gelegt werden müsste. Der grundrechtliche Schutz der Meinungsfreiheit als unmittelbarer Ausdruck der Persönlichkeit impliziert – in den Grenzen zumutbarer Selbstbeherrschung – die rechtliche Anerkennung menschlicher Subjektivität und damit auch von Emotionalität und Erregbarkeit. Demgegenüber kann bei schriftlichen Äußerungen im Allgemeinen ein höheres Maß an Bedacht und Zurückhaltung erwartet werden. Dies gilt – unter Berücksichtigung der konkreten Kommunikationsumstände – grundsätzlich auch für textliche Äußerungen in den „sozialen Netzwerken“ im Internet (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 19.12.2021 – 1 BvR 1073/20 Rn. 36 m.w.N.). Ebenfalls erheblich kann sein, ob und inwieweit für die betreffende Äußerung ein konkreter und nachvollziehbarer Anlass bestand und welche konkrete Verbreitung und Wirkung sie entfaltet. Erhält nur ein kleiner Kreis von Personen von einer ehrbeeinträchtigenden Äußerung Kenntnis oder handelt es sich um eine nicht schriftlich oder anderweitig perpetuierte Äußerung, ist die damit verbundene Beeinträchtigung der persönlichen Ehre geringfügiger und flüchtiger als im gegenteiligen Fall. Demgegenüber ist die beeinträchtigende Wirkung einer Äußerung beispielsweise gesteigert, wenn sie besonders sichtbar in einem der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglichen Medium getätigt wird. Ein solches die ehrbeeinträchtigende Wirkung einer Äußerung verstärkendes Medium kann insbesondere das Internet sein, wobei hier nicht allgemein auf das Medium als solches, sondern auf die konkrete Breitenwirkung abzustellen ist (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 19.12.2021 – 1 BvR 1073/20 Rn. 37 m.w.N.).
Die Breitenwirkung eines online abrufbaren Kondolenzbuches einer lokalen Tageszeitung ist groß. So weisen die Traueranzeigen für die Verstorbene N. bereits 1.407 Besuche (Stand: 07.02.2022) auf. Die auf der Homepage veröffentlichten Statistiken: „12.860 Trauerfälle online, 26.061 Traueranzeigen online, 30.507 Kerzen angezündet, 3.268 Kondolenzeinträge verfasst“ (Stand: 07.02.2022) sprechen ihr übriges.
In die Abwägung sind darüber hinaus auch aktuelle Bestrebungen des Gesetzgebers einzustellen. So hat er mit dem Gesetz zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität vom 30.03.2021 (BGBl. 2021 I 441) eine Qualifikation des § 185 StGB für die öffentliche – somit auch im Internet – begangene Beleidigung eingeführt. Richtet sich die Beleidigung gegen eine Person des politischen Lebens, welches bis hin zur kommunalen Ebene reicht, so ist sie gemäß § 188 StGB sogar mit einer im Mindestmaß erhöhten Strafe zu sanktionieren, wenn die Tat geeignet ist, das öffentliche Wirken der Person des politischen Lebens erheblich zu erschweren. Der Gesetzgeber reagierte hiermit auf das aktuelle Kriminalitätsphänomen öffentlich ehrverletzender Herabsetzungen in digitalen Medien und stellt klar, dass Beleidigungen, die unter dem Deckmantel vermeintlicher Anonymität im Internet begangen werden, keineswegs weniger schlimm wiegen, als solche in persona.
Die Verschärfung der vorgenannten Normen zum 01.07.2021 hat der Gesetzgeber nicht mit der Notwendigkeit eines besseren Ehrschutzes, sondern mit der bestehenden Gefahr für den freien Meinungsaustausch begründet. Er führt dazu aus: „Die eigene Meinung frei, unbeeinflusst und offen sagen und sich darüber austauschen zu können, stellt einen wesentlichen Grundpfeiler der demokratischen pluralistischen Gesellschaft dar, die der Staat mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln zu verteidigen hat.“ (BT-Drs. 19/17741, S. 1). Schutzgut des § 185 StGB ist somit nicht mehr nur die individuelle Ehre im Spannungsverhältnis zur Meinungsfreiheit, sondern die Meinungsfreiheit selbst und der Schutz demokratischer Institutionen (Hoven/Wittig, in: NJW 2021, 2397). Der wirksame Schutz der Persönlichkeitsrechte von Amtsträgern und Politikern liegt im öffentlichen Interesse und ist auch gewichtig (so zuletzt wieder: BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 19.12.2021 – 1 BvR 1073/20 Rn. 47 m.w.N.). Denn eine Bereitschaft zur Mitwirkung in Staat und Gesellschaft kann nur erwartet werden, wenn für diejenigen, die sich engagieren und öffentlich einbringen, ein hinreichender Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte gewährleistet ist (BVerfG, Beschluss der 2. Kammer des Ersten Senats vom 19.05.2020 – 1 BvR 1094/19 Rn. 32 m.w.N.)……“a.O., § 473 Rn. 7).“