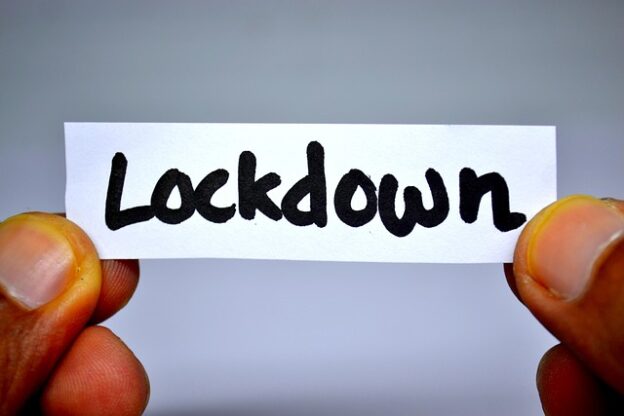Und heute im „Kessel Buntes“ u.a. beA-Entscheidungen. Hier kommt zunächst eine kleine Zusammenstellung von Entscheidungen aus dem Zivilverfahren, allerdings immer nur die Leitsätze der Entscheidungen, und zwar:
- BGH, Beschl. v. 17.01.2024 – VII ZB 22/23 – zum Zustellungszeitpunkt bei Übermittlung per beA:
1. Für die Rücksendung des elektronischen Empfangsbekenntnisses in Form eines strukturierten Datensatzes per besonderem elektronischen Anwaltspostfach (beA) ist es erforderlich, dass aufseiten des die Zustellung empfangenden Rechtsanwalts die Nachricht geöffnet sowie mit einer entsprechenden Eingabe ein Empfangsbekenntnis erstellt, das Datum des Erhalts des Dokuments eingegeben und das so generierte Empfangsbekenntnis versendet wird. Die Abgabe des elektronischen Empfangsbekenntnisses setzt mithin die Willensentscheidung des Empfängers voraus, das elektronische Dokument an dem einzutragenden Zustellungsdatum als zugestellt entgegenzunehmen; darin liegt die erforderliche Mitwirkung des Rechtsanwalts, ohne dessen aktives Zutun ein elektronisches Empfangsbekenntnis nicht ausgelöst wird.
2. Das von einem Rechtsanwalt elektronisch abgegebene Empfangsbekenntnis erbringt – wie das herkömmliche papiergebundene (analoge) Empfangsbekenntnis – gegenüber dem Gericht den vollen Beweis nicht nur für die Entgegennahme des Dokuments als zugestellt, sondern auch für den angegebenen Zeitpunkt der Entgegennahme und damit der Zustellung. (Anschluss an BVerwG, Beschluss vom 19. September 2022 – 9 B 2/22, NJW 2023, 703).
- BGH, Beschl. v. 17.1.2024 – VII ZB 2/23 – zu den Formanforderungen für einen Vollstreckungsauftrag:
Der von der Vollstreckungsbehörde in Form eines elektronischen Dokuments zu erteilende Vollstreckungsauftrag zur Pfändung und Verwertung beweglicher körperlicher Sachen nach dem Justizbeitreibungsgesetz (JBeitrG), der eine qualifizierte elektronische Signatur des bearbeitenden Mitarbeiters als der verantwortenden Person trägt, genügt den im elektronischen Rechtsverkehr geltenden Formanforderungen (Anschluss an BGH, Beschl. v. 6.4. 2023 – I ZB 84/22, NJW-RR 2023, 906).
- BGH, Beschl. v. 10.1.2024 – AnwZ (Brfg) 15/23 – zur Ersatzeinreichung und zur Wiedereinsetzung:
1. War es bereits im Zeitpunkt der Ersatzeinreichung eines Schriftsatzes möglich, die vorübergehende technische Unmöglichkeit der elektronischen Übermittlung darzulegen und glaubhaft zu machen, hat dies mit der Ersatzeinreichung zu erfolgen; in diesem Fall genügt es nicht, wenn die Voraussetzungen für eine Ersatzeinreichung nachträglich darlegt und glaubhaft gemacht werden (BGH, Beschl. v. 17.11.2022 – IX ZB 17/22, NJW 2023, 456 f.).
2. Die an die Nutzungspflicht und die an eine Ersatzeinreichung eines elektronischen Dokuments zu stellenden Voraussetzungen ergeben sich aus dem Gesetz. Dass die Rechtsmittelbelehrung darauf nicht gesondert hinweist, ist unschädlich und führt nicht zur Gewährung von Wiedereinsetzung in den vorigen Stand.
- BGH, Beschl. v. 17.1.2024 – XII ZB 88/23 – zur nicht aktualisierten beA-Software
1. Die Glaubhaftmachung der vorübergehenden Unmöglichkeit der Einreichung eines Schriftsatzes als elektronisches Dokument bedarf einer aus sich heraus verständlichen, geschlossenen Schilderung der tatsächlichen Abläufe oder Umstände. Hieran fehlt es, wenn die glaubhaft gemachten Tatsachen jedenfalls auch den Schluss zulassen, dass die Unmöglichkeit nicht auf technischen, sondern auf in der Person des Beteiligten liegenden Gründen beruht.
2. Rechtsanwälte, die ihre beA-Software nicht aktualisieren, können sich nicht auf eine technische Unmöglichkeit berufen, wenn deshalb ein fristgebundener Schriftsatz zu spät bei Gericht eingeht. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand kommt in solchen Fällen nicht in Betracht.
- OLG Zweibrücken, Beschl. v. 4.12.2023 – 9 U 141/23 – zur Wirksamkeit einer Rechtsmittelschrift:
Ein Rechtsmittel ist unzulässig, wenn die Rechtsmittelschrift zwar von einem Rechtsanwalt auf einem sogenannten sicheren Übermittlungsweg eingereicht wird, aber weder einfach noch qualifiziert elektronisch signiert wurde.