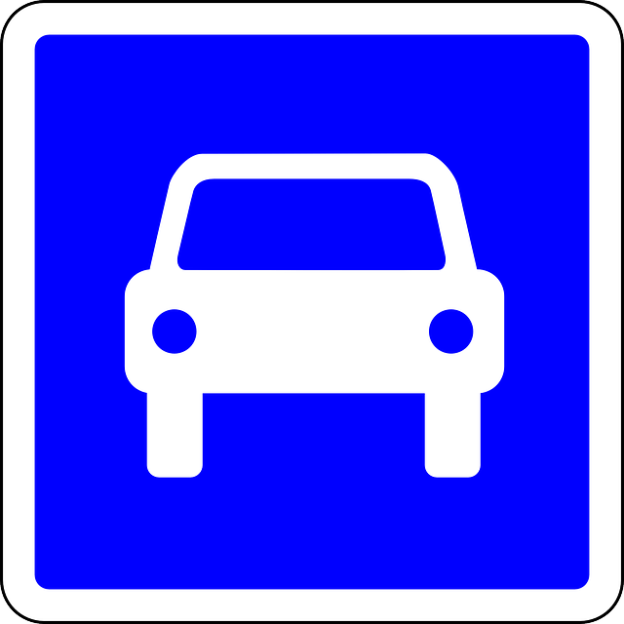Und dann die zweite Entscheidung, die mit dem OLG Celle, Urt. v. 13.12.2023 – 14 U 32/23 – auch vom OLG Celle kommt. Es geht u.a. um die Anwendung der Grundsätze des Anscheinsbeweises bei einem berührungslosen Unfall/Auffahrunfall und um die Haftungsverteilung bei einem berührungslosen Unfall.
Folgender Sachverhalt:
„Der Kläger begehrt die Feststellung, dass die Beklagten zur Zahlung von materiellen und immateriellen Schadensersatz nach einem Verkehrsunfall verpflichtet sind, bei dem er mit seinem Motorrad stürzte und verletzt wurde.
Der Kläger befuhr am 31. März 2021 mit seinem Motorrad in Begleitung seines Sohnes, dem Zeugen A., auf dessen Motorrad die B. Straße (L ) in Richtung H. Vor dem Kläger und seinem Sohn befuhr der Zeuge A1 mit seinem PKW die B. Straße in gleicher Richtung. Die aus Fahrtrichtung des Klägers gesehene Gegenfahrbahn, die die Beklagte zu 1. mit dem bei der Beklagten zu 2. haftpflichtversicherten Fahrzeug der Marke Mercedes befuhr, war im Kurvenverlauf durch einen Müllwagen blockiert, der zu diesem Zeitpunkt von Mitarbeitern des Abfallservice O. GmbH mit gelben Säcken beladen wurde. Die Beklagte zu 1. versuchte, an dem Müllwagen vorbei zu fahren, und wechselte hierzu auf die Fahrbahn des Klägers und des vor ihm fahrenden Zeugen A1. Der Zeuge A1 bremste sein Fahrzeug stark ab, um eine Kollision mit der Beklagten zu 1., die sich noch auf der Fahrbahn des Zeugen befand, zu vermeiden. Auch der Kläger, dessen Motorrad über kein ABS verfügte, machte eine Vollbremsung, geriet dabei ins Rutschen und stürzte. Die Fahrzeuge des Klägers und des Zeugen A1 kollidierten nicht. Der hinter dem Kläger fahrende Zeuge A. konnte sein Motorrad abbremsen, ohne selbst zu stürzen. Die Beklagte zu 1. wendete ihr Fahrzeug bei der nächsten Gelegenheit und fuhr zur Unfallstelle zurück. Die zugelassene Höchstgeschwindigkeit beträgt am Unfallort 70 km/h. Der Kläger, der vom Unfallort mit dem Rettungshubschrauber ins Krankhaus transportiert wurde, erlitt durch den Sturz eine Schulterblattfraktur links, eine Lungenkontusion sowie eine Schürfwunde am linken Knie. Er war infolgedessen bis zum 25. Mai 2021 arbeitsunfähig krankgeschrieben. Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 08. Juni 2021 forderte der Kläger die Beklagte zu 2. auf, ihre Haftung aus dem Unfallgeschehen vollständig dem Grunde nach anzuerkennen. Die Beklagte zu 2. lehnte jegliche Haftung ab.
Der Kläger hat behauptet, er habe zum Fahrzeug des Zeugen A1 einen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten. Er sei vor dem Sturz nicht schneller als 70 km/h gefahren. Er sei mit seinem Motorrad gestürzt, weil die Beklagte zu 1. Anlass für seine und die Vollbremsung des Zeugen A1 gegeben habe. Der Kläger war der Ansicht, dass der Unfall für ihn – auch aufgrund des fehlenden ABS – unvermeidbar gewesen sei. Ferner sei sein Motorrad durch den Sturz beschädigt worden und dieser Sachschaden betrage 2.750,00 €. Darüber hinaus seien weitere Kosten für das außergerichtliche Schadensgutachten in Höhe von 698,95 € sowie eine Kostenpauschale von 25 € angefallen. Die Heilbehandlungen des Klägers seien noch nicht abgeschlossen, wie sich aus dem ärztlichen Attest vom 19. Mai 2021 ergebe. Er könne daher seine – materiellen wie auch immateriellen – Schäden nicht abschließend beziffern, so dass ein Feststellungsinteresse bestehe.
Die Beklagten haben behauptet, der Kläger habe bereits zum Fahrzeug des Zeugen A1 keinen ausreichenden Sicherheitsabstand eingehalten und darüber hinaus die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die Beklagte zu 1. habe ohne Komplikationen an dem Müllwagen vorbeifahren können. Der Kläger habe daher seinen Sturz durch einen Bremsfehler und das Überschreiten der zulässigen Geschwindigkeit allein verursacht. Eine Haftung der Beklagten bestünde nicht. Zudem bestehe bereits kein Feststellunginteresse. Die Behandlungen des Klägers seien abgeschlossen, so dass ihm eine Bezifferung seiner Schäden möglich gewesen wäre.“
Das LG hat die Klage abgewiesen. Die Feststellungsklage sei zwar zulässig, aber in der Sache unbegründet. Der Kläger habe den Sturz seines Motorrades allein verschuldet. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme sei nicht erwiesen, dass die Beklagte zu 1. risikoreich „überholt“ habe. Eine Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer durch den Überholvorgang der Beklagten zu 1. sei nicht festzustellen. Nach Würdigung der Angaben der Parteien und der Zeugenaussagen ließe sich zwar weder ein risikoreiches Überholen der Beklagten zu 1. noch ein zu geringer Abstand des Klägers auf das Fahrzeug des Zeugen A1 sicher nachweisen. Es bestünden aber Indizien für ein zu dichtes Auffahren, die sich aus den Schilderungen der Zeugen A. und A1 ergeben würden. Nach Würdigung des Gutachtens lasse sich feststellen, dass durch das Tätigen des Handbremshebels das Vorderrad blockiert und dadurch das Motorrad Stabilität verloren habe. Infolgedessen sei das Motorrad weggerutscht und der Kläger gestürzt. Nach den Ausführungen des Sachverständigen Dipl.-Ing. O. sei jedoch keine zeitliche Kopplung zwischen der Bewegung des Motorrades und dem Fahrzeug des Zeugen A. herstellbar. Der Kläger habe damit den Nachweis der Unvermeidbarkeit nicht geführt. Vielmehr sei aufgrund der Ausführungen des Sachverständigen festzustellen, dass der Kläger den Unfall hätte vermeiden können, wenn er kontrolliert gebremst hätte. Der entstandene Schaden sei ihm daher selbst zuzurechnen.
Dagegen die Berufung, die teilweise Erfolg hatte. Auch hier verweise ich wegen des Umfangs der Gründe wegen der Einzelheiten auf den verlinkten Volltext und stelle hier nur die Leitsätze ein. Die lauten:
-
- Auch bei einem berührungslosen Unfall können die Grundsätze zum Anscheinsbeweis Anwendung finden (ebenso OLG Schleswig, Beschluss vom 17. Februar 2022 – 7 U 144/21, SVR 2022, 302; entgegen OLG München, Urteil vom 7. Oktober 2016 – 10 U 767/16, Rn. 9; OLG Hamm, Urteil vom 9. Mai 2023 – 7 U 17/23, Rn. 51)
- Gelingt es einem Verkehrsteilnehmer nicht, rechtzeitig auf eine wahrgenommene Gefahrenlage zu reagieren, und verhindert er lediglich durch einen vorherigen Sturz (hier: als Motorradfahrer) eine Kollision mit dem vorausfahrenden Kraftfahrzeug, spricht wie im Fall einer „Auffahrkollision“ der Beweis des ersten Anscheins für einen schuldhaften Verkehrsverstoß des Hinterherfahrenden.
- Wer an einer unübersichtlichen Engstelle vor einer Kurve ein Hindernis (hier: ein haltendes Müllfahrzeug) links umfährt, muss gemäß § 6 Satz 1 StVO den Gegenverkehr sichern und besonders vorsichtig prüfen, ob ein Vorbeifahren den Gegenverkehr behindern würde.