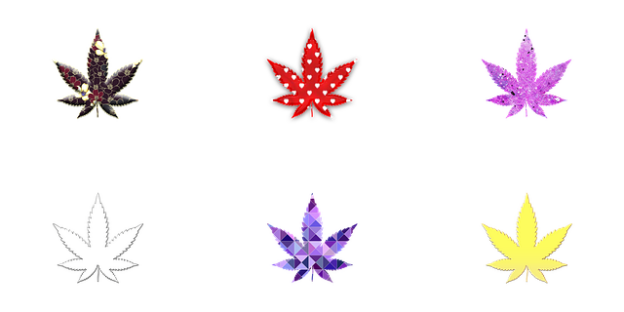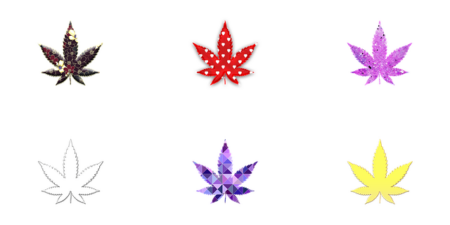Und dann die zweite Entscheidung, und zwar der OVG Sachsen-Anhalt, Beschl. v. 06.02.2025 – 3 M 4/25 – zur Anordnung des Führens eines Fahrtenbuchs. Die dagegen gerichtete Beschwerde des Antragstelles hatte keinen Erfolg:
„1. Die Beschwerde wendet zunächst ein, dass sich aus der beim Verwaltungsvorgang befindlichen Anhörung im Bußgeldverfahren vom 12. März 2024 und der auf den 16. April 2024 datierenden Erinnerung an diesen Anhörungsbogen zwar ergebe, dass der Antragsteller als Beschuldigter eines Bußgeldverfahrens wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes am 7. März 2024 geführt worden sei. Einem Beschuldigten stehe jedoch ein Aussageverweigerungsrecht zu, so dass diesem und so auch dem Antragsteller eine mangelnde Mithilfe bei der Ermittlung des Fahrzeugführers nicht mit der Konsequenz des Führens eines Fahrtenbuchs vorgehalten werden könne, solange das Ermittlungsverfahren gegen ihn nicht eingestellt worden sei. Einen Zeugenfragebogen, der nach Einstellung des ursprünglich gegen ihn eingeleiteten Ermittlungsverfahrens hätte versandt werden müssen, existiere nicht. Mache ein Beschuldigter eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens keine oder nicht ausreichende Angaben, um den Fahrzeugführer zu ermitteln, könne dies nicht zu einer Fahrtenbuchauflage führen.
Der Antragsteller kann nicht mit Erfolg geltend machen, für ihn habe als Beschuldigter keine Obliegenheit zur Mitwirkung bestanden. In der Rechtsprechung ist geklärt, dass ein „doppeltes Recht“, nach einem Verkehrsverstoß im Ordnungswidrigkeitenverfahren die Aussage zu verweigern und zugleich trotz fehlender – bzw. unzureichender – Mitwirkung bei der Feststellung des Fahrzeugführers auch von einer Fahrtenbuchauflage verschont zu bleiben, nicht besteht. Ein solches „Recht“ widerspräche dem Zweck des § 31a StVZO, nämlich der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs zu dienen. Insbesondere steht die Ausübung des Aussageverweigerungsrechts der Anwendbarkeit des § 31a StVZO unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten nicht entgegen (im Einzelnen: vgl. OVG NRW, Beschluss vom 7. März 2023 – 8 B 157/23 – juris Rn. 7 ff. unter Verweis auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungs- und Bundesverwaltungsgerichts).
Soweit der Vortrag der Beschwerde darauf abzielen sollte, dass der Antragsteller als Zeuge zu befragen gewesen wäre und deshalb die für die Aufklärung einer Zuwiderhandlung im Straßenverkehr zuständige Behörde nicht alle nach pflichtgemäßem Ermessen angezeigten Maßnahmen ergriffen haben könnte, rechtfertigt auch dies die Abänderung des Beschlusses nicht. Denn eine Zeugenstellung des Antragstellers kam vorliegend aus Rechtsgründen schon nicht in Betracht. Die Bußgeldbehörde hat den Antragsteller förmlich als Betroffenen angehört und durfte aufgrund der durchgeführten Ermittlungen fortgesetzt davon ausgehen, dass zumindest ein entsprechender Anfangsverdacht gegen ihn besteht. Die am Verfahren beteiligten Personen sind keine Zeugen, soweit die Entscheidung im Bußgeldverfahren unmittelbar gegen sie ergehen und in ihre Rechte eingreifen kann. Sie dürfen nicht als Zeugen vernommen werden, soweit das Verfahren ihre Sache betrifft; bereits bei Verdachtsgründen, die eine Verfolgung gegen eine bestimmte Person nahelegen, ist diese als Betroffener mit den gegebenen Verteidigungsmöglichkeiten anzuhören und nicht als Zeuge zu vernehmen. Diese Unterscheidung wird nicht zuletzt durch die verschiedenartigen Pflichten bzw. Rechte von Betroffenen einerseits und als Zeugen zu vernehmenden Personen andererseits bedingt. So ist ein Zeuge auch im Ordnungswidrigkeitenverfahren grundsätzlich – sofern nicht aufgrund besonderer Umstände im Einzelfall ein Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrecht in Betracht kommt – sowohl auf Aufforderung zum Erscheinen bei der Verwaltungsbehörde als auch zur Aussage in der Sache verpflichtet; bei unberechtigter Weigerung kommen Ordnungsmittel wie etwa die Verhängung eines Ordnungsgeldes oder als letzte Maßnahme sogar die Erzwingungshaft in Betracht. Für den Betroffenen besteht dagegen auch im Verfahren wegen der Verfolgung einer Ordnungswidrigkeit keine Verpflichtung, zur Sache auszusagen, hierüber ist der Betroffene auch ausdrücklich zu belehren. Jedenfalls wenn – wie hier – sich der Tatverdacht der Bußgeldbehörde zumindest auch gegen den Kraftfahrzeughalter selbst richtet, scheidet dessen Vorladung und Vernehmung als Zeuge aus Rechtsgründen aus (zum Ganzen: vgl. VGH BW, Beschluss vom 10. August 2015 – 10 S 278/15 – juris Rn. 11 m.w.N.). Es ist nicht ersichtlich, dass der Antragsteller mit Sicherheit als Fahrer ausschied, mithin das gegen ihn geführte Ordnungswidrigkeitenverfahren bereits vor Ablauf der Verfolgungsverjährung mit der Folge hätte eingestellt werden müssen, dass er als Zeuge zu befragen gewesen wäre. Die bloße fernmündliche Mitteilung des Antragstellers gegenüber der Zentralen Bußgeldstelle am 23. April 2024, wonach er nicht der Fahrer gewesen sei und drei seiner – namentlich nicht bezeichneten – Mitarbeiter, die sich sehr ähnlich sähen, als Fahrer in Betracht kämen, lässt einen solchen Schluss nicht zu.
2. Entgegen der Darstellung der Beschwerde hat das Verwaltungsgericht bei der angegriffenen Entscheidung nicht unberücksichtigt gelassen, dass sich der Antragsteller unmittelbar nach dem Erhalt des Schreibens vom 16. April 2024 telefonisch gemeldet und mitgeteilt habe, dass er drei ähnlich aussehende Mitarbeiter habe, deren Namen er ohne Weiteres benennen könne, wobei die Benennung der Namen jedoch mit den Worten abgelehnt worden sei, dass man dann weiter ermitteln müsse. …..“