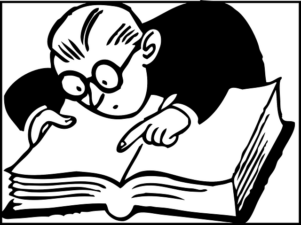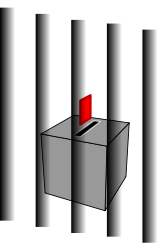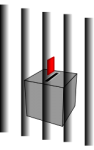Heute dann ein Tag mit Pflichtverteidigungsentscheidungen.
„2. Die sofortige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Dem Angeklagten war Rechtsanwalt P. als Pflichtverteidiger beizuordnen.
a) Die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung nach § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO liegen vor. Nach dieser Vorschrift ist der Fall einer notwendigen Verteidigung gegeben, wenn sich der Angeklagte aufgrund richterlicher Anordnung oder mit richterlicher Genehmigung in einer Anstalt befindet, was auch die Straf- und Untersuchungshaft umfasst (Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 63. Aufl. § 140 Rn. 16). Unerheblich ist dabei, ob die Pflichtverteidigerbestellung für die Sache, in der die Freiheitsentziehung vollzogen wird, oder für ein anderes gleichzeitig geführtes Strafverfahren erfolgen soll. Denn die Verteidigungsmöglichkeiten des Angeklagten sind durch den Vollzug der Freiheitsentziehung in beiden Fällen gleichermaßen eingeschränkt. (OLG Düsseldorf, Beschluss vom 30. August 1999 – 1 Ws 411/99, juris Rn. 11; LG Nürnberg-Fürth, Beschluss vom 29. Mai 2012 – 5 Qs 53/12, juris Rn. 3).
Soweit aufgrund systematischer Erwägungen zu früherer Rechtslage im Hinblick auf das Verhältnis von § 140 Abs. 1 Nr. 4 und 5 StPO a.F. vertreten wurde, § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO a.F. erfasse nicht den Fall einer in anderer Sache vollzogenen Freiheitsentziehung (dazu etwa LG Dresden, Beschluss vom 23. Mai 2018 – 14 Qs 16/18; LG Osnabrück, Beschluss vom 6. Juni 2016 – 18 Qs 526 Js 9422/16 (17/16), beide in juris), ist diese Auffassung durch die Änderung des § 140 StPO aufgrund des Gesetzes zur Regelung des Rechts der notwendigen Verteidigung vom 10. Dezember 2019 (BGBl. 2019 Teil I, 2128) überholt.
Vom weggefallenen systematischen Argument abgesehen ist eine andere Bewertung mit dem Gesetzeswortlaut des § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO auch nicht zu vereinbaren. Diese Vorschrift enthält keine Einschränkung im Hinblick auf Anlass oder Ort der Anstaltsunterbringung. Auch nach Art. 4 Abs. 4 Buchstabe b der Richtlinie (EU) 2016/1919 vom 26. Oktober 2016 (ABl. L 297/1 vom 4. November 2016, fortan: PKH-Richtlinie), deren Umsetzung § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO n.F. dient (BT-Drs. 19/13829, 34), ist es für die Gewährung von Prozesskostenhilfe in jedem Fall ausreichend, dass sich der Angeklagte in Haft befindet, ohne dass diese Voraussetzung nach Ort oder Anlass des Vollzugs der Freiheitsentziehung näher eingegrenzt würde (vgl. auch BT-Drs. 19/13829, 37).
Damit war es für die Pflichtverteidigerbestellung grundsätzlich ausreichend, dass sich der Angeklagte im Zeitpunkt der Antragstellung am 19. Februar 2021 in Untersuchungshaft in anderer Sache befand.
b) Für die Bestellung ist im gegebenen Fall unschädlich, dass der Grund der notwendigen Verteidigung im Zeitpunkt der amtsrichterlichen Entscheidung über den Antrag am 6. April 2021 bereits entfallen war.
aa) Zur früheren Rechtslage war weitgehend anerkannt, dass eine Pflichtverteidigerbestellung nur für die Zukunft möglich ist, da die Beiordnung dem Zweck einer zukünftigen ordnungsgemäßen Verteidigung und nicht dem Kosteninteresse des Angeklagten oder einem Vergütungsanspruch des Verteidigers gegen die Staatskasse dient (Nachweise bei Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 63. Aufl. § 140 Rn. 19).
bb) Nach Auffassung der Kammer gilt das nicht mehr uneingeschränkt für die neue Rechtslage. Vorliegend hatte die Beiordnung nachträglich zu erfolgen. In Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des OLG Nürnberg (Beschluss vom 6. November 2020 – Ws 120/20, juris; ähnlich LG Hamburg, Beschluss vom 26. März 2021 – 604 Qs 6/21, BeckRS 2021, 6859 Rn 9; LG Bochum, Beschluss vom 18. September 2020 – II-10 Qs 6/20, juris Rn. 42 m.w.N.) geht die Kammer davon aus, dass im Lichte der PKH-Richtlinie eine nachträgliche Verteidigerbestellung nicht versagt werden kann, wenn die Entscheidung hierüber verzögert getroffen wurde.
(1) Befindet sich der Beschuldigte – wie hier – in einer Anstaltsunterbringung, wird ihm, wenn er noch keinen Verteidiger hat, ein Pflichtverteidiger bestellt, sobald diese Unterbringung bekannt wird (§ 141 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StPO; ein Ausnahmefall gem. Abs. 2 Satz 3 der Vorschrift lag hier nicht vor). Dem Fall, dass der Beschuldigte noch keinen Verteidiger hat, steht dabei gleich, dass der gewählte Verteidiger – wie hier – bereits mit dem Antrag ankündigt, das Wahlmandat mit der Bestellung niederzulegen (vgl. BT-Drs. 19/13829, 36).
Die sachbearbeitende Staatsanwältin erhielt Kenntnis vom aktuellen Freiheitsentzug des Angeklagten spätestens am 10. Februar 2021, als sie die von der polizeilichen Ermittlung zurückgelaufene Akte, in der die Untersuchungshaft des Angeklagten in der Haftsache deutlich vermerkt war, zur Akteneinsicht an Rechtsanwalt P. verfügte. Am 22. Februar 2021 ging sodann der Beiordnungsantrag des Rechtsanwalts bei der Staatsanwaltschaft ein. Damit hatte die Staatsanwaltschaft gem. § 142 Abs. 2 i.V.m. § 141 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 StPO ihrerseits den Antrag auf Pflichtverteidigerbestellung „unverzüglich“ zu stellen, wenn sie nicht nach § 142 Abs. 2 StPO vorgehen wollte. Nach letztgenannter Bestimmung kann die Staatsanwaltschaft in Eilfällen selbst über die Bestellung entscheiden, was sie sich dann binnen Wochenfrist vom Gericht bestätigen lassen muss.
Die Strafprozessordnung definiert den Begriff der Unverzüglichkeit nicht. Ausweislich der Gesetzesmaterialien bedeutet unverzüglich zwar nicht sofort, die Bestellung muss aber so rechtzeitig erfolgen, dass die Verteidigungsrechte gewahrt werden (BT-Drs. 19/13829, 37). Diese Begriffsbestimmung nähert sich damit dem allgemeinen juristischen Verständnis der Unverzüglichkeit als „ohne schuldhaftes Zögern“ (vgl. § 121 Abs. 1 Satz 1 BGB; ähnlich LG Bochum, Beschluss vom 18. September 2020 – II-10 Qs 6/20, juris Rn. 30). Diese Auslegung steht im Einklang mit der vorrangigen und europarechtlich autonom auszulegenden PKH-Richtlinie. Nach deren Art. 6 Abs. 1 Satz 1 sind die Entscheidungen über die Bestellung von Rechtsbeiständen unverzüglich zu treffen. Dem im obigen Sinn verstandenen „unverzüglich“ der deutschen Sprachfassung der Richtlinie entsprechen gleichsinnig in der englischen Fassung „without undue delay“, in der französischen „sans retard indu“, in der italienischen „senza indebito ritardo“ oder in der polnischen „bez zb?dnej zw?oki“.
(2) Der – hier nicht aktivierten – Bestimmung des § 142 Abs. 4 Satz 2 StPO kann die konkretisierende Wertung entnommen werden, dass Unverzüglichkeit bei Wahrung der Wochenfrist noch bejaht werden kann; darüber hinaus jedoch nicht mehr (so schon zum alten Recht Lüderssen/Jahn in Löwe-Rosenberg, StPO, 26. Aufl., § 141 Rn. 19). Die Kammer hält diese Wertung jedenfalls auf den hier gegebenen Fall einer auf § 140 Abs. 1 Nr. 5 StPO beruhenden notwendigen Verteidigung regelmäßig für anwendbar. Zumindest bei einem im Inland vollzogenen und aktenkundigen Freiheitsentzug ist eine darüber hinaus gehende längere Prüfungsfrist des Beiordnungsgrundes sachlich nicht erforderlich.
(3) Die Wochenfrist – zwischen Eingang des Beiordnungsantrags des Verteidigers und der Abschlussverfügung, die den Beiordnungsantrag der Staatsanwaltschaft an das Gericht enthielt – wurde hier durch die Staatsanwaltschaft um mehr als das Doppelte überschritten, ohne dass aus der Akte nachvollziehbare Gründe hierfür erkennbar würden. Damit liegt eine nicht gerechtfertigte Verzögerung vor.
(4) Folge des Verstoßes gegen das Unverzüglichkeitsgebot ist hier, dass die Pflichtverteidigerbestellung rückwirkend zu erfolgen hat. Das ist notwendig, um ein Unterlaufen des Zwecks der PKH-Richtlinie zur effektiven Unterstützung und Absicherung der Verfahrensbeteiligten durch eine Verzögerung oder Untätigkeit auf Justizseite zu verhindern (OLG Nürnberg, Beschluss vom 6. November 2020 – Ws 120/20, juris Rn. 26; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 63. Aufl. § 142 Rn. 20; vgl. auch den 1. Erwägungsgrund der PKH-Richtlinie). Nur ein solches Verständnis stellt die praktische Wirksamkeit („effet utile“, dazu etwa Mayer in Grabitz/Hilf/Nettesheim, EUV, 71. EL August 2020, Art. 19 Rn. 57 f.; Nachweise zur Rechtsprechung des EuGH bei Potacs, EuR 2009, 465, 467 f.) der unionsrechtlichen Mindeststandards der PKH-Richtlinie (vgl. dazu deren 16. und 30. Erwägungsgrund) sicher.
(5) Die Kammer sieht sich mit vorliegender Entscheidung in Übereinstimmung mit den Erwägungen des OLG Nürnberg in dessen zitiertem Beschluss vom 6. November 2020. Sofern im dortigen Leitsatz die Pflichtverteidigerbestellung an eine „wesentliche“ Verzögerung anknüpft, versteht die Kammer das nicht als eine zusätzliche Voraussetzung für die Beiordnung – dafür geben die dortigen Beschlussgründe nichts her –, sondern als Bezugnahme auf den konkret vom Strafsenat entschiedenen Sachverhalt, in dem die eingetretene Verzögerung evident wesentlich war.“
Und dann für die Sammlung aus dem inzwischen unüberschaubaren Reservoir der Entscheidungen zur rückwirkenden Bestellung:
Für mich nicht nachvollziehbar und klar gegen Sinn und Zweck der Neuregelung.