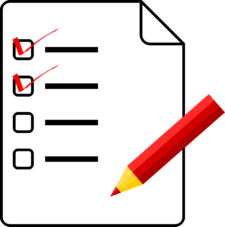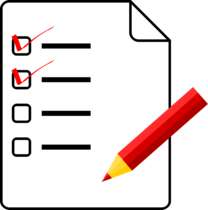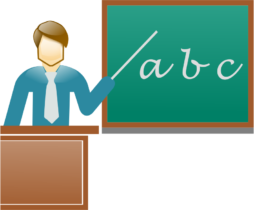Heute dann noch einmal drei „StPO-Entscheidungen“.
An der Spitze der KG, Beschl. v. 12.09.2018 – (2) 161 Ss 141/18 (40/18). Es geht um außerhalb der Hauptverhandlung gestellte Beweisanträge. Mit der Revisin war gerügt worden, dass das Tatgericht nicht vor der Hauptverhandlung gestellten Beweisanträgen nachgegangen ist. Dazu das KG:
„1. Die von der Revision erhobene Verfahrensrüge genügt nicht der gebotenen Form. Nach § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO sind bei Erhebung der Verfahrensrüge die den geltend gemachten Verstoß begründenden Tatsachen anzugeben. Sie müssen ohne Bezugnahmen und Verweisungen so umfassend und vollständig mitgeteilt werden, dass das Revisionsgericht allein aufgrund dieser Angaben prüfen kann, ob ein Verfahrensfehler vorliegt, wenn das tatsächliche Vorbringen der Revision zutrifft (vgl. BGH, Beschluss vom 7. April 2016 – 1 StR 579/15 –, juris; KG Berlin, Beschluss vom 12. Juli 2017 – 3 Ws (B) 166/17 –, juris; Meyer-Goßner/Schmitt, StPO, 61. Aufl. § 344 Rdn. 21, mwN).
Die Revision rügt einen Verstoß gegen § 244 Abs. 3 und 6 StPO, obwohl – insoweit in der Gegenerklärung klargestellt – in der Hauptverhandlung am 17. April 2018 ein Beweisantrag nicht gestellt wurde. Dabei handelt es sich auch nicht – wie der Revisionsführer meint – um eine bloße Förmelei, weil der Zeuge zu den zuvor stattgefundenen Hauptverhandlungsterminen regelmäßig geladen worden war. Nur für Beweisanträge in der Hauptverhandlung sind Ablehnungsgründe abschließend normiert (§ 244 Abs. 3, 4 und 5 StPO) und hat eine Ablehnung durch Beschluss zu erfolgen (§ 244 Abs. 6 Satz 1 StPO). Bei der Behandlung von Beweisanträgen die vor der Hauptverhandlung gestellt wurden, ist der Tatrichter gerade nicht an § 244 Abs. 3 und 6 StPO gebunden, sondern kann im Rahmen seiner Amtsaufklärungspflicht entscheiden (vgl. Trüg/Habetha, Münchener Kommentar zur StPO, 1. Aufl. 2016, § 244 Rn. 93, Rn. 55). Diese verpflichtet ihn nur dann zur Erhebung des Beweises, wenn bekannte oder erkennbare Umstände vorliegen, die zur Erhebung des Beweises drängen (vgl. BGH, Urteil vom 18. September 1952 – 3 StR 374/52 –, BGHSt 3, 169; Meyer-Goßner/Schmitt, aaO, § 244 Rn. 12 mwN). Zudem handelt es sich bei dem von der Revision vorgetragenen Begehren schon nicht um einen Beweisantrag, da er bereits eine dem Beweis zugängliche Tatsachenbehauptung vermissen lässt. Ob der Angeklagte sich „aggressiv“ verhalten und die Zeugin „verbal angegriffen“ hat, ist eine reine Wertungsfrage, die einem Beweis nicht zugänglich ist (vgl. BGHSt 37, 162).
Eine fehlerhafte Nichterhebung des beantragten Beweises könnte somit lediglich mit der Aufklärungsrüge beanstandet werden. Eine solche Verfahrensrüge ist vorliegend aber nicht erhoben worden. Die Revision rügt (nur) einen Verstoß gegen § 244 Abs. 3 und 6 StPO. Doch selbst wenn die Aufklärungsrüge in der Beweisantragsrüge mit angelegt wäre – wovon der Senat nicht ausgeht –, wäre sie erfolglos geblieben. Die Verfahrensrüge der Verletzung des § 244 Abs. 2 StPO wäre bereits nicht ordnungsgemäß unter Beachtung des § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO ausgeführt und daher unzulässig. Es sind weder konkrete Tatsachen bezeichnet, die der Tatrichter unterlassen hat zu ermitteln (vgl. Meyer-Goßner/Schmitt aaO, § 244 Rn. 102) noch ist vorgetragen, welche konkreten Umstände das Gericht zu weiteren Ermittlungen hätte drängen müssen (vgl. BGH NStZ 1999, 45 mwN; KG, Beschluss vom 16. Oktober 2017 – [5] 121 Ss 143/17 [65/17] –, juris).“