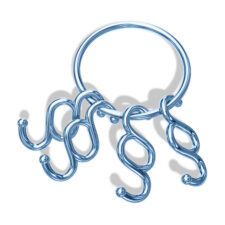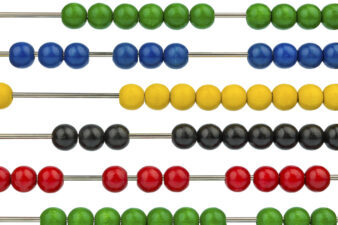In der Entscheidung geht es um den Regress eines Betroffenen gegenüber seinem Verteidiger aus dem Bußgeldverfahren. Der Einsender hatte zur Einordnung des Falls – das LG-Urteil enthält keinen Sachverhalt – darauf hingewiesen, das der Kollege in dem zugrundeliegenden Ordnungswidrigkeitenverfahren keinerlei Verteidigung hatte erkennen lassen. Seine Tätigkeit beschränkte er nur darauf, Einspruch einzulegen und gegenüber dem Mandanten, der zudem nicht rechtschutzversichert war, abzurechnen. Akteneinsicht beantragte er seche Tage vor dem HT-Termin bei Gericht. Gegen daie Verurteilung des Betroffenen beantragte man dann zwar noch die Zulassung der Rechtsbeschwerde, die aber in Ermangelung einer Begründung verworfen wurde.
Im erstinstanzlichen Zivilverfahren, mit dem der Kollege in Regress genommen wurde, verteidigte sich dieser damit, dass das AG von Amts wegen zu prüfen habe, und ein etwaiges Anwaltsverschulden daher nicht kausal sei. Das AG sah zwar das Anwaltsverschulden, aber keine Kausalität. Das LG hat das anders gesehen und verurteilt:
„Die zulässige Berufung ist begründet.
Der Kläger hat gemäß §§ 611, 675, 280 BGB einen Anspruch auf Zahlung von 1.420,51 EUR.
Der Beklagte hat seine Pflichten aus dem Mandatsverhältnis mit dem Kläger verletzt.
Der Rechtsanwalt ist verpflichtet, die Interessen seines Mandanten umfassend wahrzunehmen und sein Verhalten so einzurichten, dass Schädigungen des Mandanten vermieden werden (BGH, Urteil vom 11.02.1999 — IX ZR 14/98, NJW 1999, 1391; Urteil vom 13.03.1997 — XI ZR 81/96 NJW 1997, 2168 (2169)). Bei der Prozessvertretung muss der Anwalt die Angaben des Mandanten, wenn sie ihm lückenhaft erscheinen, vom Mandanten ergänzen lassen und hierzu Nachfrage halten (BGH, NJW 2002, 1413; NJW 2000, 730).
Auch im Verfahren mit Amtsermittlungsgrundsatz muss der Rechtsanwalt die für die Argumentation seiner Mandanten sprechenden Gründe vortragen. Der Rechtsanwalt muss dafür Sorge tragen, dass die zu Gunsten seines Mandanten sprechenden rechtlichen Gesichtspunkte möglichst umfassend berücksichtigt werden, um seinen Mandanten vor einer Fehlentscheidung des Gerichts zu bewahren (BGH, Urteil vom 07.10.2010 – IX ZR 191/09, Urteil vom 15.11.2007 – IX ZR 44/04, BGHZ 174, 205 Rn 15; Urteil vom 18.12.2008 – IX ZR 179/07, NJW 2009, 987 Rn 8).
Ein erstattungsfähiger Schaden ist dann begründet, wenn der Prozessausgang ohne die Pflichtverletzung für den Mandanten günstig ausgegangen und der eingetretene Schaden nicht entstanden wäre. Maßgeblich ist, wie der Vorprozess unter Berücksichtigung des hier unterlassenen Tatsachenvortrages nach Auffassung des Regressgerichts richtigerweise hätte entschieden werden müssen; hierzu hat der Kläger vorzutragen (BGH, Urteil vom 27.01.2000 – IX ZR 45/98, NJW 2000, 1572; Beschluss vom 05.03.2009 – IX ZR 90/06, NJW 2009, 1422 Rn 8).
Der Beklagte hat es versäumt, rechtzeitig in dem Bußgeldverfahren vor dem Amtsgerichts Zossen (Az.: 11 OWIG 483-Js-Owi 51015/19) zu beantragen, dass das dem Bußgeldverfahren zugrundeliegende Messverfahren durch ein Gutachten überprüft wird. Der Beklagte hätte unter Berücksichtigung seiner umfassenden Sorgfaltspflicht einwenden müssen, dass anhand der in dem Messverfahren vorgegebenen Parameter, die Messung nicht ordnungsgemäß erfolgte. Entgegen den Feststellungen des zuständigen Richters am Amtsgericht liegt die hier maßgebliche Markierungsrand oberhalb der Radaufstandspunkte. Diese Feststellungen hätte das einzuholende Gutachten beachten und die Messergebnis für unverwertbar erklären müssen.
Inwieweit bzw. dass, der Beklagte im Rahmen seiner bestehenden Beratungspflicht den Kläger darüber aufgeklärt hat, dass es für seine erfolgreiche Rechtsverteidigung notwendig ist, ein Gutachten zu den Messdaten einzuholen, fehlt jeglicher konkreter und nachvollziehbarer Vortrag.
Der Beklagte hatte ausweislich der beigezogenen Bußgeldakte auch die Rohmessdaten am 16.7.2020 vor der mündlichen Verhandlung vom 14.0.2020 erhalten. Er hatte damit ausreichend Gelegenheit und Zeit sich auf die mündliche Verhandlung vorzubereiten und vorab rechtzeitig Beweisanträge zur Überprüfung der Messdaten zu stellen. Diesen Beweisantrag hatte der Beklagte pflichtwidrig erst in er mündlichen Verhandlung gestellt, der dann gemäß § 77 Abs.2 Nr. 2 OWiG im Urteil des Amtsgerichts Zossen ( Az.: 11 OWIG 483-Js-Owi 51015/19) vom 14.09.2020 zurückgewiesen wurde. Bei Entscheidung nach Einholung eines Gutachtens, hätte der Kläger freigesprochen werden müssen und ihm wären keine Kosten in Höhe von 1420,51 € entstanden.
Der Beklagte kann sich nicht mit Erfolg darauf berufen, dass der Kläger ihn nicht weiter mit der Durchführung des Rechtsbeschwerdeverfahren beauftragt habe, so dass die Rechtsbeschwerde wegen fehlender Begründung als unzulässig verworfen wurde.
Das Urteil des Amtsgericht vom 14.09.2020 war mit der Rechtsbeschwerde nicht erfolgreich anfechtbar, da die Voraussetzungen der §§ 79 Abs. 1 Satz 2, § 80 OWiG nicht vorliegen.
Dem Vortrag des Beklagten kann nicht entnommen werden, mit welcher Begründung eine Rechtsbeschwerde Aussicht auf Erfolg gehabt hätte.
Aufgrund der gegen den Kläger verhängten Geldbuße in Höhe von lediglich 120,00 € kommt eine Zulassung der Rechtsbeschwerde nur unter dem Gesichtspunkt der Versagung rechtlichen Gehörs und der Fortbildung materiellen Rechts in Betracht, nicht jedoch zur Überprüfung des Verfahrens sowie zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung (§ 80 Abs. 2 Nr. 1 OWiG) in Betracht.
Die Beanstandung der Versagung des rechtlichen Gehörs ist nicht erfolgreich. Das Tatgericht hat sich ausweislich der Urteilsgründe mit den Einwänden der Verteidigung zur Geschwindigkeitsmessung auseinandergesetzt. Auch die – abgelehnte – Beweiserhebung stellt keine Verletzung des rechtlichen Gehörs dar (Art. 103 Abs. 1 GG, § 80 Abs. 1 Nr. 2 OWiG). Die Ablehnung verstößt nicht gegen das Willkürverbot (vgl. Cierniak/Niehaus DAR 2018, 181, 185).
Sofern die Verteidigung der Sache nach auch eine Verletzung des fairen Verfahrens beanstanden hätte — was im Hinblick auf die Höhe der verhängten Geldbuße ohnehin nur unter dem Gesichtspunkt einer hier nicht ersichtlichen Verletzung rechtlichen Gehörs zur Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde führen könnte, wäre mit der Antragsbegründung konkret darzulegen gewesen, dass die Verteidigung die Beiziehung konkreter Messunterlagen gegenüber der Verwaltungsbehörde geltend gemacht und dieses Begehren gegebenenfalls im Verfahren nach § 62 OWiG weiterverfolgt hat (vgl. BVerfG, Beschl. v. 12. November 2020 2 BvR 1616/18,mwN). Die Messdaten sind vorliegend an den Beklagten übermittelt worden, so dass ein entsprechender diesbezüglich begründeter Einwand nicht ersichtlich ist.
Weiter Einwände, die eine Zulassung der Rechtsbeschwerde begründen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.
Die dem Kläger durch das Bußgeldverfahren entstandenen Kosten hat der Beklagte zu tragen. Die vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten hat der Beklagte aus Verzug zu tragen.“