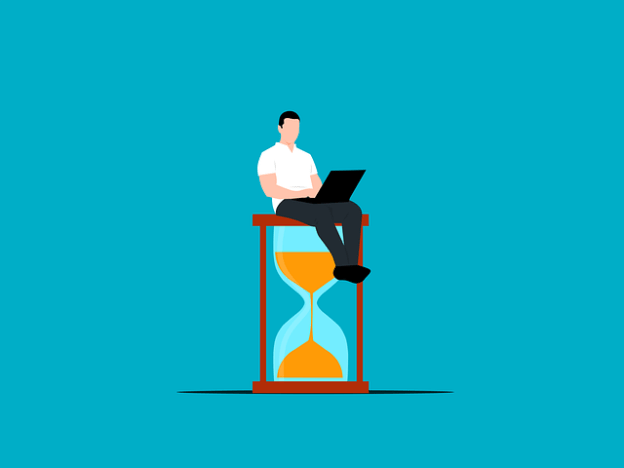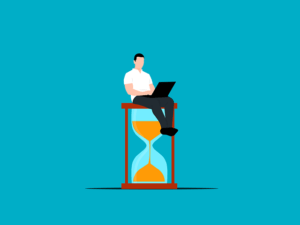Und dann als zweite Entscheidung etwas zu § 11 RVG – also Vergütungsfestsetzung gegen den Mandanten.
Die Sache kommt aus dem Zivilrecht. Der antragstellende Rechtsanwalt war Prozessbevollmächtigter der Antragsgegnerin in einem Rechtsstreit vor dem Landgericht Meiningen. Das Verfahren wurde durch Vergleich beendet.
Mit Vergütungsfestsetzungsantrag vom 23.12.2021 beantragte der Antragsteller die Festsetzung einer Vergütung gegen die Antragsgegnerin. Dem ist die Antragsgegnerin entgegengetreten. Sie hat die Verjährungseinrede erhoben und eingewandt, das Mandatsverhältnis sei ein Gefälligkeitsverhältnis gewesen.
Die Rechtspflegerin hat die Vergütungsfestsetzung abgelehnt, da evtl. Vergütungsansprüche verjährt seien. Der dagegen gerichteten sofortigen Beschwerde des Antragstellers hat die Rechtspflegerin dann abgeholfen und die Vergütung des Antragstellers auf insgesamt 3.160,48 EUR festgesetzt. Dagegen wendet sich nunmehr die Antragsgegnerin mit ihrer sofortigen Beschwerde. Zur Begründung hat sie erneut vorgetragen, das Mandatsverhältnis sei ein Gefälligkeitsverhältnis gewesen. Die Rechtspflegerin hat der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem OLG zur Entscheidung vorgelegt. Dort hatte sie im OLG Jena, Beschl. v. 15.04.2024 – 1 W 118/24 – Erfolg:
„2. In der Sache hat die sofortige Beschwerde Erfolg.
Gemäß § 11 Abs. 5 S. 1 RVG ist die Festsetzung der Vergütung abzulehnen, soweit der Antragsgegner Einwendungen oder Einreden erhebt, die nicht im Gebührenrecht ihren Grund haben.
Bei der von der Antragsgegnerin geltend gemachten Einwendung, bei dem Mandatsverhältnis habe es sich um ein unentgeltliches Gefälligkeitsverhältnis gehandelt, handelt es sich um eine solche nichtgebührenrechtliche Einwendung (BeckOK RVG/v. Seltmann, 63. Ed. 1.9.2021, RVG § 11 Rn. 67; Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, 26. Aufl. 2023, RVG § 11 Rn. 172). Über die Begründetheit des Einwands ist im Vergütungsfestsetzungsverfahren nicht zu entscheiden. Deshalb ist grundsätzlich auch weder eine nähere Substantiierung des Einwandes zu verlangen, noch eine materiell-rechtliche Schlüssigkeitsprüfung vorzunehmen (BVerfG, Kammerbeschluss vom 25.04.2016 – 1 BvR 1255/14 -, Rn. 3, juris). Eine Vergütungsfestsetzung war daher bereits auf den Einwand hin abzulehnen.
Es liegt auch kein Fall vor, in dem ausnahmsweise trotz des nichtgebührenrechtlichen Einwands eine Vergütungsfestsetzung erfolgen kann, da die Behauptung eines unentgeltlichen Gefälligkeitsverhältnisses gemessen an dem im hiesigen Festsetzungsverfahren anzulegenden Maßstab nicht offensichtlich unbegründet ist (vgl. BVerfG, wie vor). Die Antragsgegnerin hat konkret fassbare Umstände genannt, die nicht bereits von vornherein – ohne materiell-rechtliche Prüfung – als unbeachtlich angesehen werden können. Sie hat vorgetragen, dass sie und ihr Ehemann Rechtsanwälte gewesen aber nicht mehr zur Rechtsanwaltschaft zugelassen seien. Ihr Ehemann und der Antragsteller seien befreundet gewesen. Ihr Ehemann habe den Antragsgegner für das Verfahren um „Postulationsfähigkeits-Leihe“ gebeten. Die gesamte Sachverhaltsaufarbeitung sowie die vollständige Ausformulierung der Klageerwiderung sei ausschließlich durch die Antragstellerin und ihren Ehemann erfolgt. Die Haltlosigkeit der Gefälligkeitsabrede liegt damit ohne nähere Sachprüfung nicht auf der Hand, zumal der Antragsteller auch nicht vorgetragen hat, dass er Hinweise gem. § 49 Abs. 5 BRAO erteilt hat. Zwar schließt ein Verstoß gegen § 49 Abs. 5 BRAO einen Vergütungsanspruch nicht aus. Ein solcher Hinweis hätte aber ggf. eventuellen Fehlvorstellungen der Antragsgegnerin entgegengestanden. Der Einwand eines unentgeltlichen Gefälligkeitsverhältnisses ist auch nicht rechtlich unbeachtlich. Denn § 49b Abs. 1 S. 2 BRAO lässt im Einzelfall etwa mit Blick auf die Person des Auftraggebers einen – wenn auch nachträglichen – Gebührenerlass zu und es wird vertreten, dass – ggf. über § 242 BGB – auch bei Gefälligkeitshandlungen ein Vergütungsanspruch nicht besteht (vgl. AG Kenzingen, Urteil vom 19. Februar 2004 – 1 C 222/03 –, juris; BeckOK RVG/v. Seltmann, 63. Ed. 1.9.2021, RVG § 5 Rn. 1; Gerold/Schmidt/Müller-Rabe, 26. Aufl. 2023, RVG § 1 Rn. 94; a.A. HK-RVG/Hans-Jochem Mayer, 8. Aufl. 2021, RVG § 1 Rn. 23).
Der Beschluss vom 13.05.2022 war daher aufzuheben und die begehrte Vergütungsfestsetzung abzulehnen. Auf Fragen der Verjährung, an der die Antragsgegnerin wohl auch nicht mehr festhält, kommt es hierfür nicht mehr an. Ob ein Gefälligkeitsverhältnis tatsächlich vorliegt und ob bzw. in welchem Umfang ein solches einem Vergütungsanspruch entgegensteht, ist im Klageverfahren auf Zahlung der Anwaltsvergütung zu prüfen.“