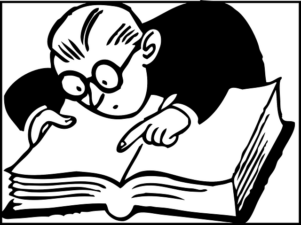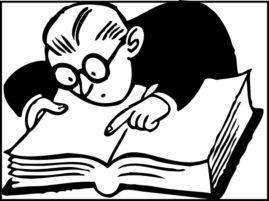Und heute dann ein „StPO-Tag“.
Den eröffne ich mit einigen Pflichtverteidigungsentscheidungen. Die habe ich dieses Mal in einem Posting zusammengefasst, weil es letztlich alles Fragen sind, zu denen ich schon häufig(er) hier Entscheidungen vorgestellt habe.
Zunächst zwei Entscheidungen zu den Gründen der Beiordnung, und zwar:
Zur Bestellung eines Pflichtverteidigers in einem Verfahren mit dem Vorwurf eines Verstoßes gegen § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BtMG, wenn dem ausländischen Beschuldigten mit dem derzeitigen Status der Duldung im Fall der Verurteilung ggf. die Ausweisung droht.
Zur Beiordnung eines Pflichtverteidigers, wenn dem Beschuldigten drei Fälle der Leistungserschleichung vorgeworfen werden und im Fall der Verurteilung eine Gesamtfreiheitsstrafe zu bilden ist.
Beides nichts Besonderes, aber kann man zur „Abrundung“ vielleicht mal ganz gut gebrauchen.
Und dann ein Beschluss zur der ebenfalls schon häufiger behandelten Frage der Aufhebung der Pflichtverteidigerbestellung, wenn der (zunächst) inhaftierte Beschulidgte rechtzeitig vor dem Hauptverhandlungstermin entlassen wird, und zwar:
Die Bestellung des Pflichtverteidigers wegen Inhaftierung des Beschuldigten fällt nicht automatisch weg, wenn der Angeklagte mindestens zwei Wochen vor der Hauptverhandlung aus der Verwahrung entlassen wird und die Verteidigung nicht aus einem anderen Grund notwendig ist. Das Gericht muss vielmehr stets prüfen, ob die Beiordnung des Verteidigers aufrechtzuerhalten ist, weil die auf der Freiheitsentziehung beruhende Behinderung trotz der Freilassung nachwirken kann.
Und dann noch etwas zum Dauerbrenner: Rückwirkung.
-
- Unter besonderen Umständen ist eine Ausnahme vom Grundsatz der Unzulässigkeit einer nachträglichen Beiordnung zu machen. Voraussetzung hierfür ist, dass der Antrag auf Beiordnung rechtzeitig vor Abschluss des Verfahrens gestellt wurde, die Voraussetzungen für eine Beiordnung gemäß § 140 StPO im Zeitpunkt der Antragstellung vorlagen und der Antrag auf Beiordnung als Pflichtverteidiger in verfahrensfehlerhafter Weise behandelt wurde.
- Unverzüglich im Sinn von § 141 Abs. 1 S. 1 StPO bedeutet zwar nicht, dass die Pflichtverteidigerbestellung sofort zu erfolgen hat; vielmehr ist der Staatsanwaltschaft eine gewisse Überlegungsfrist zuzugestehen. Bei einem Zeitablauf von zehn Wochen zwischen der Stellung des Antrages auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers und der Einstellung des Verfahrens verstößt die Staatsanwaltschaft allerdings gegen ihre Pflicht zur Herbeiführung einer unverzüglichen Entscheidung.
- § 141 Abs. 2 Satz 3 StPO, bezieht sich ausdrücklich nur auf die in § 141 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3 bezeichneten Fälle, nicht aber auf Abs. 1 der Vorschrift.
Und dann habe ich zur Rückwirkung noch zwei AG-Entscheidung: Und zwar einmal AG Verden (Aller), Beschl. v. 11.03.2024 – 9a Gs 2875 Js 43559/23 (874/24), wonach die rückwirkende Bestellung zulässig ist, was zutreffend ist. Anders sieht es dann das AG Frankfurt, Beschl. v. 19.2.2024 – 4831 Ls 204532/24 – 931 Gs -, was m.E. nicht zutreffend ist. Das AG meint außerdem, die Beiordnung komme auch deshlab nicht in Betracht, weil die Verteidigerin das Wahlmandat nicht niedergelegt habe. Ich empfehle dazu, dass das AG mal in einem gängigen StPO-Kommentar nachschauen sollte, wo es dann – vielleicht überrascht – feststellt, dass das nach überwiegender Meinung nicht erforderlich ist für die Bestellung. Warum tun AG das eigentlich nicht sofort?