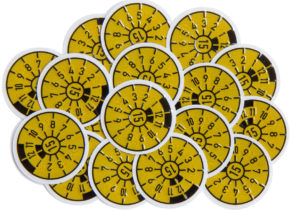Ich wollte die Entscheidung erst gar nicht vorstellen. Denn auch die in ihr behandelte Problematik ist ja eine, zu der immer wieder Entscheidung ergehen (müssen). Und: Immer wieder heben die OLG die amtsgerichtlichen Verwerfungsurteile auf, weil die AG die Basics nicht beachten. So auch hier.
Zur Veröffentlichung habe ich mich dann entschlossen, weil das OLG die Grundzüge dieser Fragen noch einmal sehr schön dargestellt hat. Vielleicht hilft es ja. Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
„1. Der Antrag auf Zulassung der Rechtsbeschwerde ist gemäß § 79 Abs. 1 Satz 2, 80 Abs. 1 OWiG statthaft und gemäß §§ 79 Abs. 3 Satz 1, 80 Abs. 3 Satz 1 OWiG, §§ 341, 344, 345 StPO form- und fristgerecht bei Gericht angebracht worden.
2. Die Verwerfung des Einspruchs nach § 74 Abs. 2 OWiG kann als Prozessurteil nur mit der Verfahrensrüge beanstandet werden.
a) Die Antragsbegründung enthält eine den Erfordernissen des § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO iVm. §§ 79 Abs. 3, 80 Abs. 3 OWiG entsprechende Verfahrensrüge. Denn soweit im Grundsatz bei der Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs darzulegen ist, was der Beschwerdeführer im Falle der Gewährung rechtlichen Gehörs vorgetragen hätte, erfährt dieser Grundsatz dann eine Ausnahme, wenn gerügt wird, die Verwerfung nach § 74 Abs. 2 OWiG beruhe auf einer unterbliebenen oder auf einer rechtsunwirksamen Ablehnung, den Betroffenen von der Verpflichtung zum persönlichen Erscheinen in der Hauptverhandlung zu entbinden. Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) ist nicht nur dann verletzt, wenn der Betroffene daran gehindert wird, zu den für die gerichtliche Entscheidung erheblichen Tatsachen Stellung zu nehmen, sondern auch dann, wenn das Gericht eine Stellungnahme des Betroffenen nicht zur Kenntnis nimmt und bei seiner Entscheidung nicht berücksichtigt (vgl. st. Senatsrechtsprechung, statt vieler: Senatsbeschluss vom 7. Januar 2019, 1 Z – 53 Ss-OWi 733/19 – 414/19; Senatsbeschluss vom 19. Juni 2019, 1 B – 53 Ss-OWi 261/19 – 148/19; Senatsbeschluss vom 1. November 2013, 1 Z – 53 Ss-OWi 471/13 – 271/13; Senatsbeschluss vom 1. August 2011, 1 Z – 53 Ss-OWi 239/11 – 134/11). Der Betroffene trägt in der Begründung seiner Rechtsbeschwerde vor, das Amtsgericht hätte kein Prozessurteil erlassen dürfen, sondern es hätte ihn auf seinen Antrag von der Pflicht zum Erscheinen in der Hauptverhandlung entbinden und auf Grund einer Beweisaufnahme in seiner Abwesenheit eine Entscheidung in der Sache treffen müssen. Damit führt er zugleich in ausreichender Weise aus, dass das Recht auf Gehör unter dem zweiten der beiden genannten Aspekte verletzt worden sei.
b) Das Rechtsmittel hat mit der Verfahrensrüge der Verletzung rechtlichen Gehörs – vorläufigen – Erfolg. Der Senat lässt die Rechtsbeschwerde aus vorgenanntem Grund zu (§ 80 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 1 OWiG). Auf die Rechtsbeschwerde des Betroffenen wird das angefochtene Urteil des Amtsgerichts aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Amtsgericht Oranienburg zurückverwiesen, wobei eine Zurückverweisung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts nicht veranlasst ist.
aa) Mit der Verfahrensrüge trägt die Verteidigung zutreffend vor, dass der Betroffene vor der Hauptverhandlung durch seinen bevollmächtigten Verteidiger mit Schriftsatz vom 24. September 2023 beantragt habe, ihn von seiner Pflicht zur Teilnahme an der Hauptverhandlung zu entbinden, er räume jedoch ein, zur Tatzeit der Fahrer des eingemessenen Kraftfahrzeugs gewesen zu sein.
Damit hat der Betroffene einen wirksamen Entbindungsantrag nach § 73 Abs. 2 OWiG gestellt. Ein solcher Antrag ist an keine bestimmte Form gebunden. Es reicht, dass das Antragsvorbringen erkennen lässt, dass der Betroffene nicht an der Hauptverhandlung teilnehmen will (KK-Senge, OWiG, 5. Aufl., § 73 Rdnr. 16; Göhler/Seitz, OWiG, 18. Aufl., § 73 Rdnr. 4; OLG Bamberg, Beschluss vom 25. März 2009 – 2 Ss OWi 1326/2008; OLG Brandenburg, 2. Bußgeldsenat, Beschluss vom 05. November 2008 – 2 Ss (OWi) 180 B/08, Senatsbeschluss vom 7. Januar 2019, 1 Z – 53 Ss-OWi 733/19 – 414/19; OLG Rostock, Beschluss vom 27. April 2011 -2 Ss (OWi) 50/11 I 63/11, zit. jew. nach juris).
Über diesen Entbindungsantrag hat das Amtsgericht nicht entschieden. Darin, dass das Amtsgericht den rechtzeitig angebrachten Entbindungsantrag übergangen und gleichwohl den Einspruch des Betroffenen wegen unentschuldigten Ausbleibens nach § 74 Abs. 2 OWiG verworfen hat, liegt eine Verletzung des Anspruchs des Betroffenen auf rechtliches Gehör begründet (Senatsbeschluss vom 7. Januar 2019, 1 Z – 53 Ss-OWi 733/19 – 414/19; Senatsbeschluss vom 19. Juni 2019, 1 B – 53 Ss-OWi 261/19 – 148/19; Senatsbeschluss vom 1. November 2013, 1 Z – 53 Ss-OWi 471/13 – 271/13; Senatsbeschluss vom 30. Mai 2011, 1 Ss-OWi 83 Z/11; Senatsbeschluss vom 1. August 2011, 1 Z – 53 Ss-OWi 239/11 – 134/11; OLG Hamm NZV 2003, 588; BayObLG DAR 2000, 578), wobei allein entscheidend ist, dass es eine verfahrenserhebliche Erklärung des Betroffenen nicht zur Kenntnis genommen und nicht darüber förmlich entschieden hat.
Denn wird ein Antrag des Betroffenen, ihn von der Pflicht zum Erscheinen in der Hauptverhandlung zu entbinden, nicht entschieden und ergeht ein Verwerfungsurteil nach § 74 Abs. 2 OWiG, liegt die Verletzung des rechtlichen Gehörs darin, dass das Gericht nicht in Abwesenheit des Betroffenen dessen Einlassung oder Aussageverweigerung, auf die der Entbindungsantrag gestützt wird (§ 73 Abs. 2 OWiG), zur Kenntnis genommen und bei seiner Entscheidung in der Sache erwogen, sondern mit einem Prozessurteil den Einspruch des Betroffenen verworfen hat. Der Betroffene hat ein Recht darauf, dass das Gericht seine Erklärungen – seine Einlassung oder seine Aussageverweigerung – zur Kenntnis nimmt und in seiner Abwesenheit in der Sache entscheidet, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen eines Abwesenheitsverfahrens erfüllt sind (vgl. Senatsbeschluss vom 7. Januar 2019, 1 Z – 53 Ss-OWi 733/19 – 414/19; Senatsbeschluss vom 19. Juni 2019, 1 B – 53 Ss-OWi 261/19 – 148/19; Senatsbeschluss vom 1. November 2013, 1 Z – 53 Ss-OWi 471/13 – 271/13; Senatsbeschluss vom 30. Mai 2011 – 1 Ss (OWi) 83 Z/11 -; Senatsbeschluss vom 1. April 2009 – 1 Ss (OWi) 48/09 – ; Senatsbeschluss vom 22. November 2007 – 1 Ss (OWi) 251 B/07 -; Senatsbeschluss vom 25. September 2006 – 1 Ss (OWi) 172 B/06 -; Senatsbeschluss vom 3. Januar 2006 – 1 Ss (OWi) 270 B/05 – Senatsbeschluss vom 10. Juli 2009 – 1 Ss (OWi) 108 Z/09; OLG Köln ZfS 2002, 254; BayObLG ZfS 2001, 185; OLG Rostock, Beschluss vom 27. April 2011 -2 Ss (OWi) 50/11 I 63/11 zit. n. juris).
bb) Ergänzend weist der Senat darauf hin, dass der Betroffene vorliegend nach § 73 Abs. 2 OWiG von seiner Anwesenheitspflicht zu entbinden gewesen wäre. Denn nach dieser Bestimmung entbindet das Gericht den Betroffenen von seiner Verpflichtung zum Erscheinen in der Hauptverhandlung, wenn er sich zur Sache geäußert oder erklärt hat, dass er sich im Termin nicht äußern werde und seine Anwesenheit zur Aufklärung wesentlicher Gesichtspunkte des Sachverhalts (beispielsweise zur Klärung der Identität) nicht erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass die Entscheidung über den Entbindungsantrag nicht in das Ermessen des Gerichts gestellt ist, dieses vielmehr verpflichtet ist, dem Antrag zu entsprechen, sofern die Voraussetzungen des § 73 Abs. 2 OWiG vorliegen (vgl. Senat aaO.; ebenso: OLG Karlsruhe – Beschluss vom 12. Januar 2018 – 2 Rb 8 Ss 839/17, zit. n. juris; OLG Koblenz NZV 2007, 251; KG VRS 111, 146; KG VRS 113, 63; OLG Naumburg StraFo 2007, 207; OLG Bamberg VRS 113, 284; OLG Stuttgart DAR 2004, 542; OLG Dresden DAR 2005, 460).
Hat – wie hier – der Betroffene in seinem Entbindungsantrag zugestanden, zur fraglichen Zeit das Fahrzeug, mit dem eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen wurde, geführt zu haben und weiter angekündigt, er werde in der Hauptverhandlung keine weiteren sachdienlichen Angaben machen, ist es in der Regel nahe liegend, ihn vom persönlichen Erscheinen zu entbinden. Dann ist nämlich von ihm eine weitere Aufklärung zum Schuldspruch nicht zu erwarten. Die mögliche Annahme, der Betroffene könne in einer Hauptverhandlung dazu gebracht werden, sein Prozessverhalten überdenken ist spekulativ und widerspricht dem erklärten Willen des Betroffenen und reicht nicht aus, ihm die Befreiung von der Erscheinungspflicht zu verweigern (vgl. KG VRS 111, 429, 430; KG VRS 113, 63).
cc) Zwar muss der Verstoß gegen das rechtliche Gehör erheblich sein (vgl. KK-Bohnert, OWiG, 5. Auflage, Einl. Rdnr. 130 m. w. N.), da nicht bei jeder Verletzung einer dem rechtlichen Gehör dienenden einfachgesetzlichen Verfahrensvorschrift rechtliches Gehörs verletzt ist (vgl. BVerfG NJW 1993, 2229 ff.). Eine solche erhebliche Verletzung rechtlichen Gehörs liegt jedenfalls dann vor, wenn die Rechtsanwendung offenkundig unrichtig war (vgl. BVerfG NJW 1985, 1150 f., 1151; BVerfG NJW 1987, 2733, 2734). Ein solcher Fall liegt hier vor. Denn durch Prozessurteil nach § 74 Abs. 2 OWiG anstatt durch Sachurteil zu entscheiden, stellt hier eine solche offenkundige Unrichtigkeit dar.“