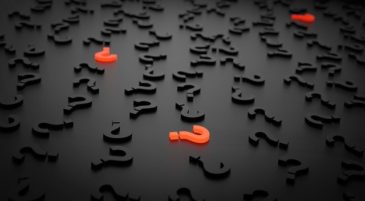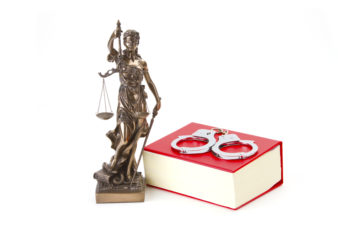Ich stelle heute dann mal wieder StGB-Entscheidungen vor. Alle drei stammen aus der Instanz.
„2. Das Rechtsmittel hat (vorläufig) Erfolg; es führt gemäß §§ 353, 354 Abs. 2 StPO zur Aufhebung des angefochtenen Urteils samt der Feststellungen und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz.
Der Schuldspruch gem. § 145a StGB – welcher im Verurteilungsfalle richtig auf „Verstoß gegen Weisungen während der Führungsaufsicht in zwei Fällen“ lauten müsste – wird von den getroffenen Feststellungen nicht getragen.
Zum Tatgeschehen hat das Amtsgericht (lediglich) folgendes festgestellt:
„Die Angeklagte steht gemäß Beschluss des Landgerichts Köln vom 30.10.2019 – 121 StVK 281/19 – seit dem 12.12.2019 unter Führungsaufsicht.
Durch Konkretisierungsbeschluss des Landgerichts Köln vom 13.03.2023 ist der Angeschuldigten aufgegeben worden, jeden ersten Montag eines Monats in der Sprechstunde in der Zeit von 14:30 Uhr bis 17:45 Uhr in der Führungsaufsichtsstelle persönlich vorzusprechen. In Kenntnis der Beschlüsse und trotz entsprechender Belehrung über die Konsequenzen etwaigen Verstöße erschien die Angeschuldigte in den Monaten April und Mai 2023 nicht in der Sprechstunde der Führungsaufsichtsstelle.
Wegen Verstoßes gegen Weisungen während der Führungsaufsicht gem. § 145a S. 1 StGB wird bestraft, wer während der Führungsaufsicht gegen eine bestimmte Weisung der in § 68b Abs. 1 StGB bezeichneten Art verstößt und dadurch den Zweck der Maßregel gefährdet.
Die vom Amtsgericht getroffenen Feststellungen sind teilweise lückenhaft und belegen nicht, dass sich die Angeklagte im Sinne von § 145a StGB strafbar gemacht hat.
a) Die Vorschrift des § 145a StGB ist eine Blankettvorschrift, deren Tatbestand erst durch eine genaue Bestimmung der Führungsaufsichtsweisung ausgefüllt wird; erst hierdurch wird die Vereinbarkeit der Norm mit Art. 103 Abs. 2 GG gewährleistet. Voraussetzung ist daher, dass die Weisung rechtfehlerfrei ist (vgl. BGH NStZ 2020, 480). Hierfür muss die Weisung, gegen die die Täterin verstoßen hat, hinreichend bestimmt sein (vgl. nur: Fischer, StGB, 71. Aufl., § 145a Rn 6). Dies ist in den Urteilsgründen darzustellen. In Anbetracht des Gebots aus Art. 103 Abs. 2 GG und des Umstands, dass § 68b Abs. 2 StGB auch nicht strafbewehrte Weisungen zulässt, muss sich zudem aus dem Führungsaufsichtsbeschluss selbst ergeben, dass es sich bei der Weisung, auf deren Verletzung die Verurteilung gestützt werden soll, um eine solche gem. § 68b Abs. 1 StGB handelt, die nach § 145a S. 1 StGB strafbewehrt ist. Dafür ist zwar einerseits eine ausdrückliche Bezugnahme auf § 68b Abs. 1 StGB nicht erforderlich, andererseits wird sie aber ohne weitere Erläuterung regelmäßig nicht ausreichen, um dem Verurteilten die notwendige Klarheit zu verschaffen (zu den vorgenannten Voraussetzungen insgesamt: BGH NStZ 2021, 733).
Dem genügt das Urteil des Amtsgerichts nicht. Die — nach den getroffenen Feststellungen — die Führungsaufsicht begründenden und die Weisungen näher ausformenden Beschlüsse der Strafvollstreckungskammer des Landgerichtes Köln vom 30. Oktober 2019 und vom 3. März 2023 werden in den Urteilsgründen – anders, als es sich zumindest dringend empfiehlt (BGH NStZ-RR 2023, 369) – nur auszugsweise mitgeteilt. Während sich aus den Feststellungen insoweit zwar noch eine hinreichend bestimmte Weisung als solche erkennen lässt, kann jedoch nicht abschließend geprüft werden, ob in dem sie anordnenden Beschluss unmissverständlich klargestellt ist, dass der Verstoß gegen diese Weisung auch strafbewehrt ist. Soweit die Urteilsgründe die Beschlüsse wiedergeben, kann ihnen dies nicht entnommen werden, da lediglich festgestellt wird, dass die Angeklagte „über die Konsequenzen etwaige] Verstöße“ belehrt worden sei. Wann eine Belehrung wie konkret über welche Konsequenzen erfolgt sein soll, bleibt indes im Ungewissen. Die Feststellungen erfahren insoweit auch keine Ergänzung durch die Beweiswürdigung, in welcher „auf den in der Hauptverhandlung verlesenen Beschluss des Landgerichts Bonn [gemeint ist wohl: Köln], BI. 3 ff. d.A.“ Bezug genommen wird. Um den Inhalt einer Urkunde zum Gegenstand der Urteilsgründe zu machen, bedarf es der Wiedergabe des Urkundeninhalts; die bloße Wiedergabe der Blattzahlen ist insoweit unbehelflich (MüKo-StPO/Wenske, 2. Aufl., § 267 Rn. 264). Ein Verstoß gegen eine strafbewehrte Weisung nach § 68b Abs. 1 StGB kann durch die getroffenen Feststellungen mithin nicht belegt werden.
b) Zudem setzt § 145a StGB als konkretes Gefährdungsdelikt (Fischer, StGB, 71. Aufl., § 145a Rn. 22; BeckOK StGB/Heuchemer, 63. Ed., § 145a Rn. 1) voraus, dass durch den Weisungsverstoß eine Gefährdung des Maßregelzwecks eintritt; dies ist dann der Fall, wenn sich die Gefahr weiterer Straftaten erhöht oder die Aussicht ihrer Abwendung verschlechtert hat. Dazu bedarf es eines am Einzelfall orientierten Wahrscheinlichkeitsurteils, das neben dem sonstigen Verhalten der Angeklagten auch die konkrete spezialpräventive Zielsetzung der verletzten Weisung in den Blick nimmt (BGH NStZ-RR 2018, 309; BGH StV 2020, 22; OLG Naumburg StV 2020, 30).
Sowohl zu dem Zweck der Führungsaufsicht als auch zur Gefährdung desselben durch das — alleine festgestellte — zweimalige Fernbleiben der Angeklagten von Gesprächsterminen in der Führungsaufsichtsstelle, verhält sich das Urteil des Amtsgerichts überhaupt nicht, sodass die Feststellungen auch insoweit lückenhaft sind und eine Verurteilung nicht zu tragen vermögen.
c) Schließlich tragen die Feststellungen auch den subjektiven Tatbestand des § 145a S. 1 StGB nicht.
Nach § 15 StGB ist ein vorsätzliches Handeln erforderlich, wobei ein bedingter Vorsatz ausreicht. Die Täterin muss wissen, dass eine bestimmte Weisung gegen sie ergangen ist; dass sie im Augenblick der Tat an die Weisung denkt, ist nicht notwendig. Das Vorsatzerfordernis erstreckt sich auch darauf, dass der Weisungsverstoß den Zweck der Maßregel gefährdet. Die Täterin muss also wissen und zumindest billigend in Kauf nehmen, dass sie durch ihren Weisungsverstoß wieder in die Gefahr der Begehung weiterer Straftaten geraten könnte. Ein bedingter Vorsatz ist auch dann möglich, wenn die Täterin hofft, jener Versuchung widerstehen zu können. Jedoch können die subjektiven Tatbestandsvoraussetzungen dann fehlen, wenn die Täterin aus einer besonderen, nachvollziehbaren Situation heraus der Weisung keine Folge leistet. Es kommt insbesondere in Betracht, dass der bewusste Weisungsverstoß aus anerkennenswerten Motiven — wenn schon nicht mit einer Rechtfertigung, z.B. bei der Nothilfe — erfolgt und damit einhergeht, dass die Täterin die Gefährdung des Maßregelzwecks nicht billigend in Kauf nimmt (MüKoStGB/Groß/Anstötz, 4. Aufl., § 145a Rn. 18).
Auch hierzu fehlen Feststellungen in dem angegriffenen Urteil. Insbesondere nach der im Urteil wiedergegebenen Einlassung der Angeklagten, nach der sie aufgrund ihrer COPD-Erkrankung häufig Angstzustände habe und nicht vor die Tür gehen könne (S. 2, 7 des Urteils), hätte sich hier eine Auseinandersetzung mit der Frage aufgedrängt, ob vorliegend auch ein nicht strafbarer fahrlässiger Verstoß gegen die erteilte Weisung oder eine vorsätzliche Terminsversäumnis, allerdings ohne Inkaufnahme einer – ebenfalls bislang nicht festgestellten (s.o.) – Maßregelgefährdung in Betracht kommt.“