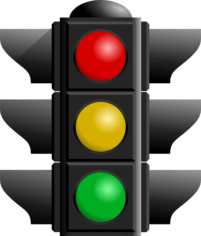entnommen openclipart
Die zweite Entscheidung des Tages kommt aus Bayern. Das BayOBlG hat im BayObLG, Beschl. v. 13.9.2021 – 202 StRR 105/21 – zur Abgrenzung der „Vernehmung“ zur „informatorischen Befragung“ und zu der Frage Stellung genommen, wann eine Durchsuchung i.S. des § 102 StPO vorliegt.
Das AG hat den Angeklagten unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln verurteilt. Die dagegen eingelegte Berufung hat das LG verworfen. Hiergegen richtet sich dann die u.a. auf die Verfahrensrüge gestützte Revision des Angeklagten. Die hatte keinen Erfolg.
Das LG hat im Wesentlichen folgende Feststellungen getroffen: Der Angeklagte bewahrte am 08.03.2019 in seiner Wohnung 7,49 g Marihuana sowie 0,42 g Cannabis-Tabakgemisch und 0,34 g Amphetamin auf. Nachdem Polizeibeamte, denen mitgeteilt worden war, dass aus der Wohnung des Angeklagten starker Marihuanageruch wahrzunehmen sei, gegen 9:10 Uhr den Angeklagten an der Wohnungstür hierauf angesprochen hatten, habe dieser sofort gestanden, dass er soeben einen „Joint“ geraucht habe. Auf Aufforderung durch die Beamten habe er die in der Wohnung befindlichen Betäubungsmittel an diese herausgegeben.
Der Angeklagte hat mit seinen Verfahrensrügen Verwertungsverbote hinsichtlich der sichergestellten Betäubungsmittel und seines Geständnisses vor der Polizei geltend gemacht. Wie gesagt: Ohne Erfolg:
„b) Die erhobenen Verfahrensrügen sind indes bereits unzulässig, weil sie den Begründungsanforderungen des § 344 Abs. 2 Satz 2 StPO nicht gerecht werden. Hiernach ist der Beschwerdeführer gehalten, die den Verfahrensverstoß begründenden Tatsachen so vollständig und genau wiederzugeben, dass das Revisionsgericht allein anhand der Begründungsschrift beurteilen kann, ob der geltend gemachte Verfahrensfehler vorliegt, wenn die behaupteten Tatsachen erwiesen wären (st.Rspr., vgl. etwa BGH, Urt. v. 28.02.2019 – 1 StR 604/17 = StV 2019, 808 = BGHR StPO § 244 Abs. 3 S. 2 Ungeeignetheit 26 = StraFo 2019, 243; 27.09.2018 – 4 StR 135/18 = NStZ-RR 2019, 26; 20.09.2018 – 3 StR 195/18 = NStZ-RR 2019, 190; Beschluss vom 01.12.2020 – 4 StR 519/19 = NStZ-RR 2021, 116 = Blutalkohol 58, 159 (2021); 29.09.2020 – 5 StR 123/20 = JR 2021, 231; 13.05.2020 – 4 StR 533/19 = medstra 2021, 42 = NStZ 2021, 178; 17.07.2019 – 5 StR 195/19, bei juris; 09.08.2016 – 1 StR 334/16 = NStZ 2017, 299 = StraFo 2017, 24 = StV 2017, 791; 19.05.2015 – 1 StR 128/15 = BGHSt 60, 238 = NStZ 2015, 541 = StraFo 2015, 381 = StV 2016, 78 = JR 2016, 78; 11.03.2014 – 1 StR 711/13 = NStZ 2014, 532 = BGHR StPO § 338 Nr. 5 Angeklagter 29 = StV 2015, 87; BayObLG, Beschluss vom 09.08.2021 – 202 ObOWi 860/21, bei juris). Dem entspricht die Rechtfertigungsschrift nicht.
aa) In Bezug auf das vor der Polizei abgelegte Geständnis, das der Beschwerdeführer wegen Verstoßes gegen die Belehrungspflicht für unverwertbar hält, fehlt es in mehrfacher Hinsicht an erforderlichem Sachvortrag, der dem Senat die Überprüfung ermöglichen würde, ob gegen die Belehrungspflicht nach § 163a Abs. 4 Satz 2 StPO i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO verstoßen wurde.
(1) Die Revision legt schon nicht dar, dass gegen den Angeklagten im Zeitpunkt des Erscheinens der Polizeibeamten an seiner Wohnungstür überhaupt ein Anfangsverdacht bestanden hatte. Die Pflicht zur Belehrung einer Person als Beschuldigten nach § 163a Abs. 4 Satz 2 StPO i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 2 StPO wird erst dann ausgelöst, wenn sich der Verdacht gegen sie so verdichtet hat, dass sie ernstlich als Täter einer Straftat in Betracht kommt (vgl. BGH, Beschluss vom 07.09.2017 – 1 StR 186/17 = wistra 2018, 91). Aus den in der Revisionsbegründungsschrift wiedergegebenen Passagen des Berufungsurteils lässt sich dies gerade nicht ableiten. Hiernach sei laut Aussage des als Zeuge vernommenen Polizeibeamten der Polizeidienststelle mitgeteilt worden, dass aus der Wohnung des Angeklagten starker Marihuanageruch wahrzunehmen gewesen sei, und der Polizeibeamte habe dann im Treppenhaus des Wohnanwesens des Angeklagten ebenfalls Marihuanageruch wahrgenommen. Hieraus resultiert indes noch keineswegs ein konkreter Anfangsverdacht gerade in Bezug auf den Angeklagten hinsichtlich eines Betäubungsmitteldelikts. Denn die Inhaberschaft einer Wohnung ist ebenso wenig strafrechtlich relevant (vgl. BGH, Urt. v. 25.04.2017 – 5 StR 106/17 = NStZ-RR 2017, 219 = StraFo 2017, 257 = StV 2018, 503) wie der bloße etwaige Konsum von Betäubungsmitteln (vgl. nur OLG Bamberg, Beschluss vom 14.10.2013 – 3 Ss 102/13 = StV 2014, 621 = OLGSt BtMG § 29 Nr. 21 m.w.N.). Dass die Polizeibeamten gerade den Angeklagten als Täter eines Betäubungsmitteldelikts konkret in Verdacht hatten, ergibt sich auch sonst aus der Rechtfertigungsschrift nicht.
(2) Zudem unterbleibt jeglicher Vortrag dazu, ob überhaupt eine die Belehrungspflicht erst auslösende „Vernehmung“ vorlag, als das Geständnis vor der Polizei abgelegt wurde. Hiervon kann nur dann gesprochen werden, wenn der Angeklagte zum damaligen Zeitpunkt bereits den Beschuldigtenstatus eingenommen hatte, was sich aber aus der Rechtfertigungsschrift ebenfalls nicht ergibt. Ungeachtet dessen ist die im Berufungsurteil erwähnte, durch die Revisionsbegründung nicht weiter untermauerte bloße „Ansprache“ des Angeklagten auf den Marihuanageruch noch keineswegs als Vernehmung im Sinne einer gezielten Befragung eines Tatverdächtigen zu werten. Vielmehr liegt mangels ausreichenden weiteren Vortrags der Revision nicht fern, dass es lediglich um eine informatorische Befragung einer zum Kreis der potentiellen Tatverdächtigen gehörenden Person zum Zwecke der Klärung ging, ob oder gegen wen gegebenenfalls förmlich als Beschuldigter zu ermitteln ist, durch die die Belehrungspflicht § 163a Abs. 4 Satz 2 StPO i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 2 bis 6 StPO noch nicht ausgelöst wurde (vgl. BGH, Beschluss vom 06.06.2019 – StB 14/19 = BGHSt 64, 89 = NJW 2019, 2627 = NStZ 2019, 539 = StraFo 2019, 376 = JR 2020, 81; 27.10.1982 – 3 StR 364/82 = NStZ 1983, 86; BayObLG, Beschluss vom 02.11.2004 – 1St RR 109/04 = VD 2005, 101 = NStZ-RR 2005, 175 = wistra 2005, 239 = StV 2005, 430 = NZV 2005, 494 = Blutalkohol 43, 312 (2006); KK-StPO/Diemer 8. Aufl. § 136 Rn 4).
(3) Darüber hinaus unterbleibt ein Vortrag dazu, ob dem Angeklagten seine Rechte aus § 163a Abs. 4 Satz 2 StPO i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 2 bis 6 StPO zum damaligen Zeitpunkt nicht ohnehin bereits bekannt waren. Ausführungen hierzu waren umso mehr erforderlich, als er vielfach und massiv vorbestraft ist, sodass es naheliegt, dass ihm schon aufgrund seiner Kontakte zu Ermittlungsbehörden und Gerichten seine Rechte bekannt waren. Sollte dies der Fall gewesen sein, durfte der Inhalt der Angaben, die er ohne Belehrung vor der Polizei gemacht hat, bei der Urteilsfindung verwertet werden (BGH, Beschluss vom 27.02.1992 – 5 StR 190/91 = BGHSt 38, 214).
(4) Schließlich scheitert die Zulässigkeit der Verfahrensrüge daran, dass der bereits in erster Instanz verteidigte Beschwerdeführer der Verwertung seines vor der Polizei abgelegten Geständnisses nicht rechtzeitig, d. h. bis zu dem in § 257 StPO vorgesehenen Zeitpunkt, mit einer konkreten Stoßrichtung widersprochen hat (vgl. grundlegend: BGH a.a.O.), was zur Rügepräklusion führt (vgl. nur BGH, Urt. v. 09.05.2018 – 5 StR 17/18 = NSW StPO § 105 (BGHintern) = NJW 2018, 2279 = StraFo 2018, 385 = StV 2018, 772 = NStZ 2018, 737 = BGHR StPO § 105 Abs. 1 Verwertungsverbot 1 m.w.N.).
bb) Soweit die Revision geltend macht, die Erkenntnisse aus der Sicherstellung der Betäubungsmittel unterlägen einem Beweisverwertungsverbot, weil sie aufgrund einer gegen den Richtervorbehalt (§ 105 StPO) verstoßenden Durchsuchung erlangt worden seien, versagt auch diese Verfahrensrüge.
(1) Da der auch für die Rüge unzulässiger Verwertung von Durchsuchungsfunden erforderliche Verwertungswiderspruch (vgl. nur BGH a.a.O.) in erster Instanz nicht erhoben wurde, ist diese Verfahrensrüge ebenfalls präkludiert und deswegen bereits unzulässig.
(2) Ungeachtet dessen kam es weder nach dem Vortrag der Revision noch nach den Gründen des Berufungsurteils zu einer Durchsuchung. Kennzeichnend für eine Durchsuchung im Sinne des § 102 StPO ist das ziel- und zweckgerichtete Suchen staatlicher Organe nach Personen und Sachen oder zur Ermittlung eines Sachverhalts, um etwas aufzuspüren, was der Inhaber der Wohnung von sich aus nicht offenlegen oder herausgeben will (vgl. BVerfG, Beschluss vom 05.05.1987 – 1 BvR 1113/85 = BVerfGE 75, 318 = NJW 1987, 2500 = WuM 1987, 303 = DVBl 1987, 1062 = Rbeistand 1987, 120 = MDR 1987, 903 = JuS 1988, 149; Löwe-Rosenberg/Tsambikakis StPO 27. Aufl. § 102 Rn. 1). Hiervon kann schon deshalb nicht ausgegangen werden, weil der Angeklagte die Betäubungsmittel auf die „Ansprache“ durch die Polizei an der Wohnungstür sofort freiwillig herausgegeben hat, so dass es zu einer Durchsuchung deshalb gar nicht kam.
(3) Für das Vorliegen eines Verwertungsverbots nach § 136a Abs. 1 Satz 3, Abs. 3 StPO aufgrund einer etwaigen Ankündigung einer Durchsuchung unter Verstoß gegen den Richtervorbehalt ergeben sich nach dem Revisionsvortrag schon keine Anhaltspunkte.“
M.E. eine dieser typischen bayerischen Fleißarbeiten, die von Zitaten strotzen, obwohl das alls gar nicht nötig gewesen wäre. Denn:
Man kann nur den Kopf schütteln über den Verteidiger. Dem scheinen die Grundkenntnisse im Recht der Beweisverwertungsverbote zu fehlen. Denn inzwischen sollte bei jedem Verteidiger angekommen sein, dass – wenn ein Beweisverwertungsverbot geltend gemacht wird – in der Hauptverhandlung widersprochen werden muss und dass der Umstand, dass widersprochen worden ist, dann auch in der Revision im Rahmen der Begründung der Verfahrensrüge vorgetragen werden muss. Und damit wäre es m.E. gut gewesen. Denn aus dem Grund ist die Entscheidung – im Ergebnis – zutreffend.
Aber: Das BayObLG muss natürlich einer staunenden (?) Fachwelt mitteilen, was es im Übrigen von der Sache hält. Und da ist die Entscheidung m.E. falsch. Denn der Angeklagte hätte als Beschuldigter belehrt werden müssen und seine ohne Belehrung gemachten Angaben wären damit, wenn widersprochen worden wäre, unverwertbar gewesen. Denn der Verdacht gegen ihn im Hinblick auf ein BtM-Delikt hatte sich zum Zeitpunkt der Befragung bereits so verdichtet, dass er als Täter einer Straftat in Betracht kam (zur Beschuldigteneigenschaft Burhoff in. Burhoff (Hrsg.), Handbuch für das strafrechtliche Ermittlungsverfahren, 9. Aufl., 2022, Rn 1041 ff.). Ich halte fest: Der Polizeidienststelle wird mitgeteilt worden, dass aus der Wohnung des Angeklagten starker Marihuanageruch wahrzunehmen ist, Polizeibeamte nehmen dann im Treppenhaus des Wohnanwesens des Angeklagten ebenfalls Marihuanageruch wahr, der Angeklagte öffnet die Wohnungstür. Bei den Umständen soll der Angeklagte dann nicht als Täter einer Straftat – eines BtM-Delikts, und zwar zumindest Besitz von BtM – in Betracht. Man fragt sich, was eigentlich noch passieren muss, bis man in Bayern als Beschuldigter angesehen wird? Für mich unverständlich, aber: Bayern eben.